AG Bernau v. 18.09.2019: Vorlage an das BVerfG: Sind die Regelungen zum Verkehr und/oder/Erwerb von Cannabis verfassungswidrig?
Das Amtsgericht Bernau (Beschluss vom 18.09.2019 - 2 Cs 226 Js 7322/19 (346/19)) hat entschieden:
| 1. |
Das Verfahren wird ausgesetzt und gemäß Artikel 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.
|
| 2. |
Das Amtsgericht Bernau hält alle Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes, soweit sie Cannabisprodukte in der Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG mit der Folge aufführen, dass der unerlaubte Verkehr mit diesen Stoffen den Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes unterliegt, für verfassungswidrig.
| 3. |
Hilfsweise hält das Amtsgericht Bernau die Strafvorschrift des § 29 Abs. 1Nr. 1 BtMG in der Alternative des Erwerbens von Cannabis i. V. m. Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG für verfassungswidrig.
|
Vorbemerkung:
Im vorliegenden Volltext des Beschlusses sind alle vom Gericht benutzten Hyperlinks durch den Text „[folgt eine URL]“ersetzt, weil diese großemteils für die responsible Darstelung insbesonder auf Smartphones zu lang sind. Zudem besteht die Gefahr, dass nach einigen Jahren die Links nicht mehr funktionieren. Wer den doch zahlreichen Links nachgehen will, findet hier eine PDF-Volltextversion des Beschlusses.
Gründe:
„Vorwort“
Seit bald einem halben Jahrhundert wird der Umgang mit Cannabis mit Ausnahme des bloßen Konsumierens durch das Betäubungsmittelgesetz in verschiedenen Ausprägungen unter Strafe gestellt. Dies deshalb, weil in der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz sämtliche Cannabisprodukte aufgeführt wurden. Seit dem wurden in der Bundesrepublik Deutschland geschätzt weit über 10 Millionen strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Menschen geführt, die entgegen der bestehenden Gesetzeslage den Umgang mit Cannabis pflegten. Weit über eine halbe Million Menschen sind infolge der Prohibitionsgesetzgebung aufgrund von Verhängung von Freiheitsstrafen, Arresten bzw. des Verbüßens von Ersatzfreiheitsstrafen inhaftiert worden.
Allein im Jahr 2018 machten konsumbezogene Cannabisdelikte mit 179.700 registrierten Fällen 51% aller Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aus (insgesamt 350.662 Fälle, vgl.: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018). 82% aller erfassten Ermittlungsverfahren wegen Delikten mit Cannabisbezug sind rein auf Konsumenten bezogen (vgl. ebd.). Trotz einer Einstellungsquote bei Konsumenten von durchschnittlich 2/3, dürften mit Blick auf die jährlich steigenden Zahlen konsumbezogener Cannabisdelikte ( im Jahr 2019 : 186455 Fälle laut Polizeilicher Kriminalstatistik ) nach wie vor jährlich und zwar überwiegend mittels des Strafbefehlsverfahrens um die zwanzigtausend Menschen auch wegen Besitzes, Erwerbens oder sonstigen Verschaffens von Cannabis, selbst bei sehr geringen Mengen, durch deutsche Straf- und Jugendgerichte verurteilt worden sein ( Vgl. insoweit unten Seite 122). In weiteren sicher weit über 10.000 Fällen jährlich sind ihre Verfahren durch die Staatsanwaltschaften und Gerichte, nachdem die Angeklagten sich vor ihnen zu verantworten hatten, gegen Geld - oder Arbeitsauflagen eingestellt worden. Durch die erfolgten Verfahren und Verurteilungen wurden ganze Familien betroffen, Menschen in ihren Entwicklungsprozessen behindert und stigmatisiert sowie mit weiteren Rechtsfolgen wie Führerscheinentzug oder Verlustes des Arbeitsplatzes staatlich versehen. Trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse bezüglich der Pflanze Cannabis und ihrer Gefährlichkeit, der internationalen Entwicklungen, allgemeiner Erkenntnisse sowie der zwischenzeitlich geänderten gesellschaftlichen Auffassungen reagiert der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland nicht, bleibt tatenlos und hält an der umfassenden Cannabisprohibition fest.
Die Väter und die Mütter des Grundgesetzes haben mit Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz unter Beachtung des Gewaltenteilungsprinzips für einen solchen Fall die dritte Gewalt mit dem Recht der Prüfung von möglicherweise ehemals verfassungsgemäßen, aber nunmehr verfassungswidrigen Gesetzen versehen. Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz gibt der 3. Gewalt mithin vorliegend den Straf- und Jugendgerichten nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung das Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung einer verfassungswidrigen Strafgesetzgebung anzurufen (vgl. statt aller von Münch/ Kunig Grundgesetz Kommentar zu Art 100 Rdnr.3 und 4 mit weiteren Nachweisen und Bezügen zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle,v MKS,Rn.3. ) Von dieser Verpflichtung macht das vorlegende Gericht nunmehr entsprechend des auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abgelegten Amtseides Gebrauch. Soweit die gesetzgeberische Gewalt trotz aller Erkenntnisse, wissenschaftlicher und sozialer Veränderungen eine vielleicht ehemals verfassungsgemäße, jetzt aber ein zur Überzeugung des Gerichts verfassungswidrige Gesetzgebung nicht ändert, so muss bei einer von den Verfassern des Grundgesetzes gewollten vernünftigen Gewaltenteilung eine Änderung durch die 3. Gewalt herbeigeführt werden. Hiernach ist es dringend geboten, dass sich das Bundesverfassungsgericht, das sich nun über 26 Jahre nicht mehr mit der Cannabis-Prohibition auseinandergesetzt hat, mit der Frage befasst, ob die Verfolgung von Millionen von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wegen des Umgangs mit Cannabis noch zeitgemäß ist und den Ansprüchen einer freiheitlichen Gesellschaft und dem Auftrag des Grundgesetzes, insbesondere Minderheiten zu schützen, entspricht.
Das Gericht hat im Rahmen der erfolgten mündlichen Verhandlung und des ergangenen Beschlusses bewusst auf die Anhörung von Sachverständigen verzichtet und sich auf allgemeingültige Quellen bezogen. Es konnte dabei weiter auf gerichtsbekannte Informationen zurückgreifen. So ist der Unterzeichner dieser Vorlage nicht nur seit 25 Jahren im Straf- und Jugendstrafrecht tätig, sondern auch seit zwei Jahrzehnten Vortragender zum Thema Cannabis. Er ist zugleich Buchautor zum Thema und hat im Rahmen seiner Autoren – und Vortragstätigkeit umfassend recherchiert. Auch hat er das Betäubungsmittel Cannabis, wie übrigens viele Richterkollegen und Staatsanwälte in Jugend,- Studenten und Referendarzeiten, selber konsumiert.
Bezüglich der Begründung des Beschlusses hat das Gericht nach eigener Prüfung teilweise wortwörtliche Passagen, insbesondere zu den neuen entscheidungserheblichen Tatsachen aus der vom Deutschen Hanfverband durch Rechtsanwälte erstellten Mustervorlage übernommen (vgl. BL.98 ff. der Akte). Diese wurde zuvor bereits Anfang September 2019 in verschiedenen Fachzeitschriften, so der Kritischen Justiz, der NStZ und der Neuen Juristischen Wochenschrift (Jahrgang 2019, Heft 37) veröffentlicht. Auch hat das Gericht insbesondere hinsichtlich der zur hilfsweise gestellten Überprüfung des § 29 Abs. I Nr.1 BtMG teilweise auf wörtliche Begründungen aus der Vorlageentscheidung des Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.März 2002 zurückgegriffen (vgl. - 2 BVL 8/02 -), da diese heute wesentlich mehr Berechtigung haben als noch im Jahre 2002.
Unter weiterer Berücksichtigung der zeitlichen Ressourcen, die einem Amtsgericht zur Verfügung stehen, genügt diese Vorlage den Anforderungen an einer Richtervorlage gemäß Art 100 GG i.v.m. § 81 BVerfGG (vgl. insoweit auch BVerfGE 13,167,168). Das Gericht ist sich insoweit bewusst, dass bei genügend zur Verfügung stehender Zeit sicher eine noch bessere dogmatische Auseinandersetzung mit bestehender Verfassungsrechtsprechung möglich gewesen wäre. Das kann aber ein Amtsgericht nicht leisten und dürfte zur sicheren Überzeugung seitens der Verfasser des Grundgesetzes auch nicht erwartet worden sein, da ansonsten Amtsgerichte kaum in der Lage wären Art.100 GG anzuwenden.
Prozessgeschichte, Sachverhalt und rechtliche Würdigung
1. Prozessgeschichte
Mit Verfügung vom 07.05.2019 beantragte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gemäß §§ 39 Abs. 1 Nr. 3, 33 BtMG den Erlass eines Strafbefehls in Höhe von 20 Tagessätzen zu je 30,00 € (gleich 600,00 €). Auch wurde beantragt dem Angeschuldigten die Kosten des Verfahrens gemäß § 465 StPO aufzuerlegen. Dem Angeschuldigten wurde zur Last gelegt, am 03.01.2019 2,6 g Netto Marihuana mit sich geführt zu haben, ohne eine Erlaubnis für den Erwerb von Betäubungsmitteln zu besitzen. Nach Eingang des Strafbefehlsantrages mit Datum vom 03.06.2019 und einer ersten Vorprüfung durch das Gericht eröffneten sich Bedenken gegen den Erlass des beantragten Strafbefehls und zwar bezüglich einer Verfassungswidrigkeit einer solchen Verurteilung. Der Angeschuldigte wurde mit Datum vom 26.07.2019 hierauf aufmerksam gemacht und bezüglich der Bestellung eines Pflichtverteidigers angeschrieben. Infolge wurde mit Datum vom 19.08.2019 gemäß § 140 Abs. 2 StPO eine Pflichtverteidigerin bestellt. Zeitgleich wurde gemäß § 408 Abs. 3 Satz 2 StGB eine Verhandlung anberaumt, da das Gericht zur Auffassung gelangt ist, dass von der rechtlichen Beurteilung der Staatsanwaltschaft vorliegend abgewichen werden könnte.
Im Rahmen der am 18.09.2019 durchgeführten Hauptverhandlung ließ sich der nunmehr Angeklagte zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft vollumfänglich und glaubhaft geständig ein. Infolge konnte das Gericht folgende Feststellungen treffen:
Der Angeklagte, der in strafrechtlicher Hinsicht noch nicht aufgefallen ist, absolvierte nach einer normalen Sozialisation das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 2,9. Infolge schloss sich ein Studium der Elektrotechnik an. Hier befindet sich der Angeklagte im 3. Semester und beabsichtigt auch nach Absolvieren des Studiums andere Menschen auszubilden. Der heute 24-jährige Angeklagte lebt noch zu Hause und erhält BAföG in Höhe von 33,00 €, im Übrigen wird er von seinen Eltern unterstützt. Der Angeklagte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Das Gericht vermochte zur Person des Angeklagten weiter festzustellen, dass gegen diesen bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäß § 29 BtMG geführt wurde. So wurde der Angeklagte am 30.11.2017 gegen 01:05 Uhr, als er mit einem Freund mit Skateboards unterwegs war, durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen einer freiwilligen Herausgabe überreichte der hiesige Angeklagte den kontrollierenden Polizeibeamten eine Metalldose aus seinem mitgeführten Rucksack und übergab diese mit den Worten „hier ist etwas drin“. Die Polizeibeamten entdeckten s.g. Long Paper und einen Chrusher mit Restanhaftungen von Marihuana sowie eine Cliptüte mit Marihuana mit einem Bruttogewicht von 4,5 g Brutto und eine Cliptüte mit einem Tabak Marihuana Gemisch von ca. 2,1 g Brutto. Nach Abschluss der Ermittlungstätigkeit wurde das durch die Polizei eingeleitete Verfahren an die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zur Entscheidung abgegeben. In der Folge wurde gemäß § 31a Abs. 1 BtMG von der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft am 02.02.2018 abgesehen. Die Entscheidung wurde dem Angeklagten formlos mitgeteilt. Zuvor wurde im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Barnim gemäß § 2 Abs.12 StVG über das Ermittlungsverfahren unterrichtet.
Zur Sache konnte das Gericht sodann aufgrund der geständigen Einlassung des Angeklagten feststellen, dass dieser am Mittwoch, den 02.01.2019 in Berlin-Kreuzberg im Görlitzer Park – einem bekannten Drogenumschlagsplatz - von einer unbekannt gebliebenen Person 2,6 g Marihuana erworben hat. In den Stunden danach war er mit einem Freund unterwegs und führte das erworbene Marihuana mit sich. Im Rahmen einer durch die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs erfolgten Tatortortbereichsfahndung wurde der Angeklagte wie auch sein Freund gegen 0:00 Uhr des Tattages festgestellt. Im Rahmen der Feststellungen bemerkten die ermittelnden Beamten starken Cannabisgeruch und durchsuchten infolge den Angeklagten. Hier fanden die Beamten die 2,6 g Marihuana und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Auch unterrichteten sie die zuständige Straßenverkehrsbehörde erneut gemäß § 2 Abs.12 StVG.
Im Rahmen der Hauptverhandlung erklärte der Vorsitzende, dass eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit nach § 31a BtMG oder 153 StPO angezeigt sei. Weder der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Verteidigerin noch der Angeklagte erteilten zur Einstellung ihre notwendige Zustimmung. Der Angeklagte erklärte insoweit „ich fühle mich nicht schuldig“.
3. Rechtliche Würdigung:
Aufgrund des festgestellten Sachverhalts hat sich der Angeklagte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG in der Alternative des Erwerbens in Verbindung mit der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BtMG strafbar gemacht. Soweit die Staatsanwaltschaft ursprünglich einen Antrag wegen Besitzes von Cannabis gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG gestellt hatte, hat das Gericht in der Hauptverhandlung rechtlichen Hinweis auf ein Erwerben gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG erteilt. Denn soweit der Angeklagte, nachdem er das Betäubungsmittel erwarb, es im Rahmen der Überprüfung durch Polizeibeamte im Besitz hatte, handelt es sich auch um eine Straftat gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG. Diese Straftat fällt jedoch als sogenannte mitbestrafte Nachtat im Rahmen einer strafrechtlichen Gesamtbewertung weg, da es sich bei § 29 Abs.1 Nr.3 BtMG lediglich um einen Auffangtatbestand handelt (vgl. Patzak/ Bohnen, Betäubungsmittelrecht 3. Auflage, Rdnr. 93). Der Angeklagte wäre mithin nur wegen Erwerbens von Betäubungsmittel, hier Marihuana, zu bestrafen gewesen.
Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung hätte dies darüber hinaus für den Angeklagten weitere Konsequenzen nach sich gezogen. Abgesehen von der Stigmatisierung käme eine weitere Rechtsfolge dazu, nämlich die des §25 Absatz 1 Nr.4 des Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Dieser kommt insbesondere zur Anwendung, wenn Personen, die im pädagogischen Bereich mit Jugendlichen zu tun haben oder diese ausbilden, wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurden:
So heißt es dort:
| „Personen, die (…) wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz (…) rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses (…) nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden.“ |
Für Erzieher, Lehrer, Ausbilder in Betrieben oder in sonstigen pädagogischen Berufen kommt diese Regelung also faktisch einem Berufsverbot gleich. Die Beschränkung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung. Danach kann die betreffende Person wieder in ihrem Beruf arbeiten. Das Missachten des Ausbildungsverbots stellt für den Arbeitgeber eine Ordnungswidrigkeit dar. Für den Angeklagten ergibt sich eine Informationspflicht. Auch wird es in den Auszügen aus dem Bundeszentralregister eingetragen. Der §25 JArbSchG differenziert analog zu den Regelungen im BtMG, nicht nach den Betäubungsmitteln, die zur Verurteilung geführt haben, ob ein Täter wegen harter oder weicher Drogen verurteilt wurde, ob weiterhin Drogen genommen werden oder ein echtes Suchtverhalten vorliegt. Auch wird nicht nach der Höhe der Strafe differenziert. Selbst bei einer Feststellung der Schuld gemäß § 59 StGB, also einer Verwarnung mit Strafvorbehalt, würde dies zu einem zeitlichen Berufsverbot führen. Sollte der Angeklagte mithin nach Absolvieren seines Studiums – wie angedacht – auch Lehrlinge betreuen oder im Rahmen einer anderen selbst ehrenamtlichen Tätigkeit Jugendliche betreuen wollen, wäre es ihm nicht erlaubt. Auch dürfte der Angeklagte, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, im Falle einer Verurteilung sicher im Rahmen des Beantragens einer Fahrerlaubnis weitere Probleme bekommen. So dürfte er sich im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprüfung sicher einer medizinischen psychologischen Untersuchung unterziehen müssen.
An einer Bestrafung des Angeklagten oder einer Schuldfeststellung im Sinne des § 29 Abs. 5 BtMG sieht sich das Gericht jedoch gehindert, weil es aufgrund allgemein zugänglichen Quellen zur Überzeugung gekommen ist, dass die hier zur Anwendung kommenden Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes und deren hieraus folgenden zuvor aufgezeigten Problematiken nach Maßgabe des Beschlusstenors zur sicheren Auffassung des Amtsgerichts verfassungswidrig sind. Denn wenn die Aufnahme von Cannabis in der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BtMG mit der Folge der Strafbarkeit gemäß § 29 BtMG gegen das Grundgesetz verstößt, darf das Gericht den Angeklagten nicht bestrafen und auch nicht die Schuld mit der Folge, dass ihm auch die Kosten des Verfahrens auferlegt werden müssten, feststellen. Der Angeklagte wäre damit freizusprechen. Sind die vorgenannten Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes hingegen mit dem Grundgesetz vereinbar, dann ist der Angeklagte zu bestrafen. Das Gericht musste daher das Verfahren aussetzen und mit folgender Begründung gemäß Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen.
A. Zulässigkeit der Vorlage soweit Cannabisprodukte insgesamt in der Anlage 1. zu § 1 Abs. 3 BtMG aufgeführt werden und sämtlicher Umgang mit diesem Betäubungsmittel gemäß des Betäubungsmittelgesetzes unter Strafe gestellt wird.
1. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts als rechtlich bindende Grundlage
Das Bundesverfassungsgericht hat sich zuletzt mit einer Prüfung der Cannabisprohibition aufgrund mehrerer zulässiger Vorlagen gemäß Art.100 GG im Jahr 1994 umfassend befasst. Eine Vorlage der Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.03.2002 wurde durch eine Kammer des Bundesverfassungsgerichts mit Datum vom 29.06.2004 als unzulässig eingestuft, da nach Ansicht der Kammer die an eine erneute Vorlage gestellten besonderen Begründungsanforderungen nicht erfüllt gewesen seien. Auch habe das Gericht es seinerzeit verabsäumt, einen konkreten Bezug der für verfassungswidrig gehaltenen Vorschriften zu der konkreten Entscheidung im Ausgangsverfahren herzustellen (vgl. BvR 8/02).
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 09.03.1994 – 2 BvR 2031/92 – auf die Vorlagen von insgesamt sieben Strafgerichten, Strafkammern und Amtsgerichten lautet in ihren amtlichen Leitsätzen:
| 1. |
|
||||
| 2. |
|
||||
| 3. | Soweit die Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes Verhaltensweisen mit Strafe bedrohen, die ausschließlich den gelegentlichen Eigenverbrauch geringer Mengen von Cannabisprodukten vorbereiten und nicht mit einer Fremdgefährdung verbunden sind, verstoßen sie deshalb nicht gegen das Übermaßverbot, weil der Gesetzgeber es den Strafverfolgungsorganen ermöglicht, durch das Absehen von Strafe (vgl. § 29 Abs. 5 BtMG) oder Strafverfolgung (vgl. §§ 153 ff. StPO, § 31a BtMG) einem geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt der Tat Rechnung zu tragen. In diesen Fällen werden die Strafverfolgungsorgane nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31a BtMG bezeichneten Straftaten grundsätzlich abzusehen haben. |
||||
| 4. | Der Gleichheitssatz gebietet nicht, alle potenziell gleich schädlichen Drogen gleichermaßen zu verbieten oder zuzulassen. Der Gesetzgeber konnte ohne Verfassungsverstoß den Umgang mit Cannabisprodukten einerseits, mit Alkohol oder Nikotin andererseits unterschiedlich regeln. |
b) Entscheidung vom 29.06.2004 – 2 BVL 8/02 –
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 29.06.2004 – 2 BVL 8/02 – auf den Vorlagebeschluss des Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.03.2002 stellt fest, dass die Vorlage den Begründungsanforderungen für eine erneute Richtervorlage nicht gerecht wird. Diese Begründungsanforderungen wurden wie folgt festgelegt:
| „Das vorlegende Gericht ist gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG an die frühere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gebunden. Ihr kommen gemäß § 31 Abs. 2 BVerfGG Gesetzeskraft und Rechtskraftwirkung zu (vgl. BVerfGE 33, 199 (203) m. w. N.). Da das vorlegende Gericht im Falle einer erneuten Vorlage einen Spruch begehrt, der im Gegensatz zu der früheren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht, muss es im Einzelnen die Gründe dafür darlegen, dass die Rechtskraft der früheren Entscheidung eine erneute Sachprüfung nicht hindert. Die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung bezieht sich zwar stets auf den Zeitpunkt, in dem sie ergeht; sie erfasst damit nicht solche Veränderungen, die erst später eintreten. Sie steht einer erneuten Vorlage daher nicht entgegen, wenn das vorlegende Gericht sich auf neue Tatsachen beruft, die erst nach der früheren Entscheidung entstanden oder bekannt geworden sind. Eine erneute Vorlage ist in solchen Fällen aber nur dann zulässig, wenn sie von der Begründung der früheren Entscheidung ausgeht; das vorlegende Gericht muss den in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dokumentierten Rechtsstandpunkt einnehmen und neue Tatsachen darlegen, die vor diesem Hintergrund geeignet sind, eine von der früheren Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts abweichende Entscheidung zu ermöglichen.“ |
Das Amtsgericht Bernau bei Berlin sieht nunmehr diese vom Bundesverfassungsgericht seinerzeit verlangten Voraussetzungen für gegeben an.
2. Neue entscheidungserhebliche Tatsachen
Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Tatsachen, welche im Hinblick auf die gesundheitliche, medizinische, politische, ökonomische, soziologische und kriminologische Einordnung und Wirkung von Cannabis nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 entstanden oder bekannt geworden sind, dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Gefährlichkeit von Cannabis, Cannabis als Medizin, internationale Entwicklungen im Bereich der Regulation, die Forderungen der UN Commission on Drugs, Erkenntnisse zu den Gefahren des Drogenmarktes, ökonomische Effekte der Prohibition und nationale Forderungen zur Abschaffung der Cannabisprohibition. Die aufgeführten Tatsachen sind für die Beurteilung der Vereinbarkeit der angegriffenen Norm erheblich und machen mithin eine erneute Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit der Cannabisprohibition erforderlich.
a) Die Gefährlichkeit von Cannabis
Durch Anlage I des deutschen Betäubungsmittelgesetzes wird Cannabis als „Marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen“ definiert. Cannabis enthält 121 nachgewiesene Phytocannabinoide, wovon Tetrahydrocannabinol ( abgekürzt THC ) und Cannabidiol ( abgekürzt CBD ) die bekanntesten und meist untersuchten sind (vgl. WHO Expert Commitee on Drug Dependence, Fortieth Report, 2018, S. 24). Von der Cannabispflanze werden hauptsächlich die Blütenstände (Marihuana) konsumiert oder aber die Cannabispflanze wird zu verschiedenartigen Cannabisprodukten verarbeitet: so u. a. Cannabisharz (Haschisch) oder Cannabiskonzentrat (Haschischöl), wobei die Wirkstoffkonzentration je nach Beschaffenheit der Pflanze und Art der Verarbeitung variieren kann 1.
Cannabis ist die in den Ländern Europas am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Etwa 26,3 Prozent der Bürger der Europäischen Union (15 bis 64 Jahre alt) haben in ihrem Leben Erfahrung mit Cannabis gemacht – rund 87,7 Millionen Menschen (vgl. hierzu Hoch, Eva/Schneider, Miriam, Cannabis: Potenzial und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (Kurzbericht), 2017, S. 42 – im Folgenden zitiert als CaPRis-Studie – Kurzbericht). Ein Blick in die Statistiken zur Altersverteilung der Cannabiskonsumenten zeigt, dass es sich beim Cannabiskonsum hauptsächlich um ein jugendtypisches Phänomen handelt. Bereits zwischen dem 25. und 27. Lebensjahr geht der Konsum deutlich zurück (vgl. zu Statistiken zur Altersverteilung und Ubiquität, Möller, Yannick: Die Prohibitionspolitik als Element sozialer Kontrolle, 2018, S. 219 f. – im Folgenden zitiert als Möller, S.).
Auch wenn die Forschung noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich bei Cannabis um eine der weltweit besterforschtesten Substanzen, die eine ca. 100-jährige intensive Forschungsvergangenheit aufweist (Krumdiek, Nicole, Cannabis Sativa L. und das Aufleben alter Vorurteile, NStZ 2008, S. 437).
Damit gehören Cannabis und Haschisch in Deutschland, aber auch weltweit zu den wohl am meisten konsumierten und gleichzeitig – im Hinblick auf ihr Gefährdungspotenzial – zu den am meisten diskutierten Drogen.
In seiner Entscheidung vom 09.03.1994 – 2 BvR 2031/92 – stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass nach Einschätzung des Gesetzgebers die von dem Genuss von Cannabisprodukten ausgehenden gesundheitlichen Gefahren erheblich seien. Diese ursprüngliche Einschätzung des Gesetzgebers sei zum Zeitpunkt der Entscheidung nunmehr umstritten, jedoch sei die den Vorlagebeschlüssen zugrundeliegende Annahme mangelnder Gefährlichkeit ungesichert. In einer kursorischen Auseinandersetzung mit dem damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand in der Literatur stellten sich die von Cannabisprodukten ausgehenden Gesundheitsgefahren zum Zeitpunkt der Entscheidung als geringer dar, als der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes angenommen habe. Es verblieben dennoch auch nach dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht unbeträchtliche Gefahren und Risiken, sodass die Gesamtkonzeption des Gesetzes in Bezug auf Cannabisprodukte auch weiterhin vor der Verfassung Bestand habe (BVerfG, Entscheidung vom 09.03.1994 – 2 BvL 43, 51, 63, 64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92 –, S. 177 ff. – anders: Abweichende Meinung des Richters Sommer zum Beschluss des Zweiten Senats vom 09.03.1994 – 2 BvL 43, 51, 63, 64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92-).
Auch in seiner – auf die Vorlage des Amtsgerichts Bernau vom 11.03.2002 ergangenen – Entscheidung vom 29.06.2004 stellt das Bundesverfassungsgericht noch fest, dass „nach damaligem Erkenntnisstand nicht unbeträchtliche Gefahren und Risiken“ im Hinblick auf die Wirkung des Cannabiskonsums für den Einzelnen und die Allgemeinheit verblieben. Die in diese Einschätzung einfließende Annahme über Risikofaktoren (keine körperliche Abhängigkeit, nur geringe unmittelbare gesundheitliche Schäden bei mäßigem Genuss von Cannabis, Möglichkeit einer psychischen Abhängigkeit trotz geringen Suchtpotenzials, Möglichkeit der Störung der Persönlichkeitsentwicklung bei Jugendlichen) seien durch die vom Amtsgericht zitierten neueren Stimmen der Wissenschaft nicht erschüttert. Schließlich wäre und sei die mögliche Auslösung eines sogenannten „amotivationalen Syndroms“ umstritten (BVerfG, Beschluss vom 29.06.2004, – 2 BvL 8/02 –, Rdnr. 43). Eine eingehende inhaltliche Befassung mit dem ausführlichen Sachvortrag des Amtsgerichts Bernau zur Frage der wissenschaftlichen Einordnung der Auswirkungen von Cannabiskonsum war indes nicht erfolgt, da die Vorlage bereits als unzulässig abgewiesen wurde.
Seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in den Jahren 1994 und 2004 über die Vorlagen des Landgerichts Lübeck u. a. und der des Amtsgerichts Bernau bei Berlin hat die Beurteilung der Gefährlichkeit sowie insbesondere auch der Einsatz der Hanfpflanze Cannabis und der in ihr enthaltenen Inhaltsstoffen zu medizinischen Zwecken sowohl national als auch international eine erhebliche Veränderung erfahren, welche schon für sich genommen nach den durch das Bundesverfassungsgericht 1994 aufgestellten Maßstäben eine erneute Überprüfung der Vereinbarkeit der vorgelegten Normen mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben erforderlich macht.
aa) Gefährlichkeit
Ihren deutlichsten und aktuellsten Ausdruck findet die Neubewertung der Gefährlichkeit von Cannabis in dem im Jahr 2018 durch das WHO Expert Commitee on Drug Dependence veröffentlichten kritischen Bericht über die derzeitige Einordnung von Cannabis durch das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel 3 (vgl. WHO Expert Commitee on Drug Dependence, Critical Review – Cannabis and cannabis resin, World Health Organisation 2018 – im Folgenden zitiert als WHO, Critical Review 2018). Auf Grundlage der darin vorgenommenen grundsätzlichen Revision von Cannabis und der darin enthaltenen Wirkstoffe stellte die Kommission in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, unter Verweis auf Art. 3 des Einheitsabkommens über Betäubungsmittel fest, dass Präparate, welche auf reinem Cannabidiol (CBD) basieren, in den internationalen Drogenkontrollabkommen nicht mehr gelistet sein sollten (siehe: Brief der Weltgesundheitsorganisation WHO an UN-Generalsekretär António Guterres, 2019, aufrufbar: [folgt eine URL]). Hinsichtlich der Cannabispflanze und ihres Harzes, der Cannabisextrakte und Cannabisöle sowie Delta 9 THC und anderer THC-Isomere bedürfe es der Fortsetzung einer kritischen Überprüfung der derzeitigen Einordnung.
Zur Erläuterung wird im Rahmen des 40. Berichts des WHO mit dem Titel Drug Expert Commitees on Drug Dependence festgestellt, dass von CBD keinerlei Gefahren für die Gesundheit ausgehen und durch den Konsum von CBD keine Abhängigkeiten entstehen. Bezüglich Cannabis wird konstatiert, dass der Konsum verschiedene Effekte mit sich bringt, wie zum Beispiel Schwindel und Beeinträchtigungen der motorischen und kognitiven Funktionen. Der Konsum von Cannabis könne zudem die Fahrtauglichkeit beeinflussen. Weiter wird festgestellt, dass die meisten der negativen Effekte auf chronischen Gebrauch zurückzuführen sind. So wird der regelmäßige Konsum von Cannabis mit Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit wie z. B. Depressionen und Angststörungen in Verbindung gebracht. Dies gelte vor allem für junge Menschen, bei denen sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Cannabis könne grundsätzlich auch eine physische Abhängigkeit begründen. Weiterhin wird festgestellt, dass die therapeutische Wirkung von Cannabis gegen Krankheiten wie etwa Rückenschmerzen, Depressionen, Schlafstörungen und Schmerzerkrankungen in verschiedenen Ländern anerkannt ist und die Forschung diesbezüglich weiter voranschreitet. Schließlich stellt das Komitee fest, dass es keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Gefährlichkeit von Cannabis mit der anderer – in Schedule I und IV gelisteten – Substanzen vergleichbar ist und daher die Prüfung hinsichtlich einer angemesseneren Einordnung von Cannabis fortgesetzt werden sollte (vgl. ebd.).
Aus den vielfältigen nationalen und internationalen Veröffentlichungen soll nunmehr im Folgenden – unter Berücksichtigung der Entscheidungsgrundlage des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1994 – ein Überblick über Ergebnisse wesentlicher wissenschaftlicher Arbeiten und Studien gegeben werden. 4
bb) Kurzfristige Wirkungen
Kurzfristige Cannabiswirkungen werden in Literatur und Forschung weniger kontrovers diskutiert und stehen nicht im Fokus bei der Frage nach einer etwaigen Gefährlichkeit des Konsums von Cannabis (so auch Möller, S. 75). Die akute Toxizität von Cannabis ist sehr gering. Tödliche Überdosierungen sind bisher nicht bekannt geworden (so auch WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.1.). Akute körperliche Wirkungen sind Herzrasen und eine leichte Blutdrucksteigerung, gefolgt von einem Blutdruckabfall beim Aufstehen. Diese Effekte zeigen eine ausgeprägte Toleranzwirkung. Cannabinoide vermindern die Darmmotilität und zeigen eine übelkeit- und brechreizunterdrückende Wirkung (Kleiber, Dieter/Kovar, Karl-Arthur, Auswirkungen des Cannabiskonsums. Eine Expertise zu pharmakologischen und psychosozialen Konsequenzen, 1997, S. 240 – im Folgenden zitiert als Kleiber/Kovar 1997, S.).
Niedrige Dosen rufen eine milde Sedation und Euphorie hervor, Personen im Cannabisrausch erfahren eine subjektiv gesteigerte Gefühlsintensität in verschiedenen Sinnesmodalitäten und ein verlangsamtes Zeitempfinden. Im Zusammenhang mit einer intensivierten Geschmackswahrnehmung kommt es häufig zu einem gesteigerten Appetit (so auch WHO, Critical Review 2018, Section 3.2.). Unter Cannabiseinfluss ist die Konzentrationsfähigkeit herabgesetzt, ebenso zeigen sich Leistungseinbußen im Bereich Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit. Bei hoher Dosierung kann der Konsum von Cannabis zu Halluzinationen und zu Depersonalisationserlebnissen führen. Ab einer Konzentration von 300 ug/kg Körpergewicht (Rauchen) überwiegen dysphorische (vor allem Angst-) Zustände und unangenehme Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Brennen im Hals, Mundtrockenheit, Reizhusten und Gliederschwere. Die dysphorischen Zustände können im Extremfall die Form akuter Panikreaktionen und leichter paranoider Zustände annehmen. Diese Reaktionen finden sich vor allem bei relativ unerfahrenen, unvorbereiteten Konsumenten (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 241).
Akute Intoxikationspsychosen sind möglich. Für die Existenz einer eigenständigen „Cannabispsychose“ finden sich hingegen keine Belege (vgl. hierzu u. a. Möller, S. 86 ff.). Das Auftreten von Flashbacks (sog. Echorausch) kann nicht befriedigend erklärt werden, doch sind sie nach alleinigem Cannabiskonsum offensichtlich sehr selten (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 241).
cc) Langfristige pharmakologisch-klinische Wirkungen
Langfristige Folgen des Cannabiskonsums werden im Vergleich mit den akut auftretenden Wirkungen wesentlich kontroverser diskutiert. Allerdings kann auch hier festgestellt werden, dass die massiven Gesundheitsgefahren, die der Gesetzgeber 1971 und 1980 sah, durch heutige wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr bestätigt werden. Schädliche Auswirkungen auf körperliche Funktionen lassen sich zumeist nicht eindeutig nachweisen, wobei die Ungefährlichkeit ebenfalls nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde (vgl. hierzu Möller, S.78). 5
Nach langfristigem Cannabisrauchen ist eine Beeinträchtigung der Bronchialfunktion möglich. Es kann zu Entzündungen, Obstruktion, Bronchitis und zu präkanzerösen Veränderungen kommen. THC besitzt jedoch auch eine bronchienweitende Wirkung. Das Rauchen von Cannabis muss dennoch insgesamt als ein Risikofaktor für die Entstehung von Krebserkrankungen des Aerogestivtraktes und der Lunge angesehen werden. Insbesondere der häufige Beikonsum von Tabak führt zu additiven Effekten (vgl. hierzu u.a. Möller, S. 77). Das vorhandene Risiko, nach alleinigem Cannabisrauchen an Krebs zu erkranken, ist jedoch nicht eindeutig quantifizierbar (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S.241, so auch CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3; WHO Critical Review 2018, Section 3.1.3.).
THC hat in vitro und in vivo immunsuppressive Eigenschaften, deren klinische Relevanz derzeit noch unklar ist (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S. 241).
Cannabinoide üben in vielfältiger Weise Einfluss auf die Plasmaspiegel verschiedener Hypophysenhormone aus. Bei Langzeitkonsumenten kann es potenziell zu einer Beeinträchtigung der Spermatogenese bzw. zu einer Störung des Menstruationszyklus kommen, diese Effekte sind jedoch reversibel. Es ist nicht sicher auszuschließen, dass bei jungen Heranwachsenden die veränderten Hormonspiegel zu einer Verzögerung der Pubertät führen können. Die Datenlage auf diesem Gebiet ist jedoch sehr uneinheitlich und eine abschließende Beurteilung daher nicht möglich (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S. 241 f.; Möller, S. 77).
Auch eine Beeinträchtigung des Fötuswachstums und der Entwicklung vom Neugeborenen aufgrund eines Cannabiskonsums der Mutter während der Schwangerschaft ist nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen. Das Ausmaß und die klinische Bedeutung solcher Beeinträchtigungen werden allerdings in der Literatur kontrovers diskutiert (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S. 242; Möller, S.77, sowie CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3).
Das Auftreten von physischen Gehirnschäden konnte nicht nachgewiesen werden, frühere Befunde erwiesen sich als nicht reproduzierbar (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S.242; Möller, S. 77). Dementgegen wird durch die CaPRis-Studie nunmehr festgestellt, dass chronischer Cannabiskonsum im Zusammenhang steht mit strukturellen Veränderungen in Gehirnregionen, welche eine hohe Dichte an CB1-Rezeptoren aufweisen – insbesondere Amygdala und Hippocampus, Strukturen verantwortlich für die Gedächtnisbildung (vgl. CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3). Diese Veränderungen können laut CaPRis-Studie in direktem Zusammenhang mit der THC-CBD-Ratio der konsumierten Cannabisprodukte stehen (vgl. ebd.).
Für die Mehrzahl der pharmakologischen Effekte von Cannabis wird bei langfristigem, regelmäßigem Konsum hoher Dosen eine Toleranzentwicklung festgestellt (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S.242).
dd) Psychische sowie soziale Konsequenzen
Die allgemeine Annahme, dass der Konsum von Cannabis eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit nach sich zieht, lässt sich nicht nachweisen. Zwar lässt sich zeigen, dass stärker problembehaftete Personen besonders häufig konsumieren, Belege für eine schädigende Substanzwirkung von Cannabis lassen sich hingegen nicht finden (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S.243; Möller S. 81; anders in Teilen CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3 f.; Thomasius, Rainer, Cannabiskonsum und -missbrauch: Deutschlands Suchtproblem Nr. 3, MschrKrim, 2006, S. 116 ff. – im Folgenden zitiert als Thomasius 2006; zu sozialen Auswirkungen von Cannabiskonsum vgl. Fergusson, D.M./Boden J.M., Cannabis use and later life out-comes. Addiction, 103, 69-76). Unter der akuten Drogeneinnahme kommt es zu Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit. Vor allem Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistungen sowie die Psychomotorik sind eingeschränkt (vgl. hierzu u.a. Kleiber/Kovar 1997 S.244; CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 2; WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.7.). Nachwirkungen dieser akuten Folgen können noch Stunden bis Tage, in seltenen Fällen sogar Wochen bestehen bleiben. Nach Absetzen des Konsums verbessern sich die Leistungen jedoch wieder, und es ist nicht davon auszugehen, dass der Cannabiskonsum bleibende kognitive Beeinträchtigungen nach sich zieht (vgl. hierzu u.a. Kleiber/Kovar, 1997 S.244; WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.7.; Soellner/Rummel, Cannabiskonsum – zwischen Verharmlosung und Dramatisierung, ZJJ 3/2008, S. 307 ff. – im Folgenden zitiert als Soellner/Rummel 2008).
Von großer Bedeutung scheint auch hier die Stärke und Frequenz des Cannabiskonsums zu sein: Die genannten Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprobleme wurden in der Regel nur bei sehr schweren Konsumformen (bei Personen, die über einen längeren Zeitraum mehrmals täglich konsumierten) beobachtet; ein leichter bis mittlerer Konsum (hierunter wurde in den entsprechenden Studien ein immerhin mehrmals wöchentlicher Cannabisgebrauch verstanden) zieht hingegen keine länger anhaltenden kognitiven Beeinträchtigungen nach sich (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S.244).
Kleiber/Kovar stellten in ihrer Expertise von 1997 im Hinblick auf die Frage, inwiefern Cannabiskonsum Einfluss auf Entstehung und Verlauf von Psychosen hat, die Tendenz fest, dass ein starker, mehrmals täglicher Konsum eine Verstärkung produktiver Symptome wie Wahn und Halluzinationen bewirken kann, weniger harte Konsumformen hingegen nicht (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 244 f. sowie WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.8; Möller, 86 ff.).
Zu konstatieren ist auch, dass Cannabisabhängigkeit unter psychiatrisch vorbelasteten Personen weitaus häufiger als in unbelasteten Vergleichsgruppen auftritt (so auch Soellner, Renate, Cannabismissbrauch und -abhängigkeit und deren Stellenwert für die juristische Argumentation, Praxis der Rechtspsychologie 2010, S. 354 – im Folgenden zitiert als Soellner 2010). Was die zeitliche Abfolge der comorbid auftretenden Störungen anbetrifft, lässt sich jedoch feststellen, dass diese sowohl überwiegend vor dem Beginn des Cannabiskonsums als auch vor dem Eintreten der cannabisbezogenen Störung zu lokalisieren sind. Dies gilt insbesondere für externalisierende Störungen wie das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom und Störungen des Sozialverhaltens, aber auch für internalisierende Störungen wie Angststörungen und Depressionen (Soellner 2010, ebenda).
Nach wie vor umstritten ist die Frage, ob Cannabis ein unabhängiger Risikofaktor für die Ausbildung einer Schizophrenie ist bzw. das Risiko psychotisch vorbelasteter Personen, an Schizophrenie zu erkranken, erhöht. Prof. Dr. Otto Lesch6 stellt auf Grundlage seiner aktuellen Forschungsergebnisse fest, dass Cannabis in der Ursache von Schizophrenie keinen besonderen Stellenwert hat. Vielmehr handele es sich bei Schizophrenie um eine primäre Denkstörung, die im Jugendalter auftritt, und auf der ganzen Welt sehr ähnliche Häufigkeiten zeigt (0,6 bis 1,0 Prozent), gleichgültig ob in diesen Gegenden Cannabis geraucht wird oder nicht. Viele Studien deuteten vielmehr daraufhin, dass CBD-haltige Cannabisprodukte sogar einen protektiven Effekt haben können, während eine Psychosegefahr eher von Produkten mit sehr hohen THC-Dosen ausgehe (Univ. Prof. Lesch: „Die Tabak- und Alkohollobby braucht mit Cannabis einen Außenfeind“, published by Medical Cannabinoids Research & Analysis vom 06.11.2018, https://www.mcra.eu/author/medical-cannabis-research-analysis-gmbg/). Auch durch eine Studie von Ashley C. Proal/Jerry Fleming/Juan A. Galvet-Buccolini/Lynn E. DeLisi (Proal, Ashley C./Fleming, Jerry/Galvet-Buccolini, Juan A./DeLisi, Lynn E., A controlled family study of cannabis users with an without psychosis, 19.09.2013) wird im Ergebnis festgestellt, dass durch den Cannabiskonsum als solchen das Psychose- /Schizophrenierisiko nicht steigt.
Dagegen kommt die CaPRis-Studie zu dem Ergebnis, dass Cannabiskonsum je nach Ausmaß des Konsums und Alter der Konsumenten das Risiko für affektive Störungen, Angststörungen, Suizidalität und psychotische Störungen jeweils (geringfügig) erhöhe (vgl. CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3; so auch Patzak, Jörn/Marcus, Alexander/Goldhausen, Sabine, Cannabis – wirklich eine harmlose Droge? NStZ 2006, S. 259).
ee) Cannabis-Abhängigkeit und Cannabis als Einstiegsdroge
Die Existenz eines Cannabis-Abhängigkeitssyndroms, welches neben maßgeblichen psychischen Auswirkungen auch geringe physische Symptome zeigen kann, ist mittlerweile unbestritten (vgl. Soellner 2010; Hall, W./Johnston, L./Donnelly, N., Epidemiology of cannabis use and its consequences, in: Kalant, H./Corrigall, W.A./Hall, W./Smart, R.G. (Hrsg.), The Health effects of cannabis, 1999, S. 69-125 – im Folgenden zitiert als Hall 1999; WHO, Critical Review 2018, Section 2.1.2., CaPRis Studie – Kurzbericht, S. 4). Der Konsum von Cannabis führt jedoch keineswegs zwangsläufig zu einer psychischen Abhängigkeit (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 245). Physische Entzugssymptome wie Zittern, innere Unruhe, erhöhte Körpertemperatur, Gewichtsverlust und Schlafstörungen sind selten. Sie treten nur nach Entstehung einer ausgeprägten Toleranz auf (vgl. WHO Critical Review 2018, Section 2.1.2.; Möller, S. 78 ff.). Gerade das typische Ausstiegsszenario des „Hinausreifens“ spricht gegen ein hohes Abhängigkeitspotenzial von Cannabis (vgl. Krumdiek 2008, S.442).
Für die Einordnung der Bedeutung einer solchen Abhängigkeit ist zu beachten, dass eine solche nicht primär aus den pharmakologischen Wirkungen der Droge zu erklären ist, ohne vorab bestehende psychische Stimmungen und Probleme zu berücksichtigen. Die Abhängigkeit von Cannabis sollte vielmehr als Symptom solcher Probleme gesehen werden (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 245; ebenso Möller, S.80).
Unumstritten ist ferner, dass das Suchtpotenzial von Cannabis wesentlich geringer ist, als das manch anderer – gleich ob legal oder illegal – psychoaktiver Substanzen wie Nikotin, Alkohol oder Heroin.
Die Zahl der Personen, die aufgrund cannabisbezogener Störungen Beratungsstellen aufsuchen, ist in den letzten Jahren zwar leicht gestiegen ( CaPRis Studie – Kurzbericht, S. 4) aber im Jahr 2017 und 2018 wieder leicht gesunken. Um sich das konkrete Gefährdungspotential vor Augen zu führen muss man sich aber die durch die Deutsche Suchthilfestatistiken aufgelisteten Zahlen der Jahre 2013 bis 2018 genau vor Augen führen.
Nach der Deutschen Suchthilfestatistik (vgl. Homepage Deutsche Suchthilfestatistik) ließen sich aufgrund einer Hauptdiagnose Cannabis
im Jahre 2013 insgesamt 28.789,
imJ ahre 2014 insgesamt 31.367,
im Jahre 2015 insgesamt 33.251,
im Jahre 2016 insgesamt 33.757,
im Jahre 2017 insgesamt 31.411,
im Jahre 2018 insgesamt 31.912
Personen behandeln oder beraten.
Im stationärer Behandlungen befanden sich von den zuvor genannten Personen
im Jahre 2013 insgesamt 2.930 Personen,
im Jahre 2014 insgesamt 3.367 Personen,
im Jahre 2015 insgesamt 3.893 Personen,
im Jahre 2016 insgesamt 3.897 Personen,
m Jahre 2017 insgesamt 2.893 Personen,
im Jahre 2018 insgesamt 3.195 Personen.
Insoweit bleibt im Wesentlichen festzustellen, dass angesichts der Millionen von Konsumenten sich relativ wenige wegen der Hauptdiagnose Cannabis in ambulanter oder stationärer Behandlung begeben. Im Durchschnitt liegen die Zahlen bezüglich des problembehafteten Konsumierens von Cannabis um die 30.000 Fälle jährlich. Der Durchschnitt der stationär behandelten Fälle liegt ca. bei 3.500 jährlich. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Zahlen der vergangenen Jahre im Verhältnis zu den noch bekannten Zahlen in den Vorjahren leicht erhöht haben. Eine wesentliche Rolle hierbei dürfte allerdings eine verbesserte Aufklärungsarbeit, verbesserte Beratungsangebote, veränderte Klassifizierungsmethoden der Einrichtung sowie anderweitig psychische Beeinträchtigung oder deren Behandlungsbedürftigkeit spielen (vgl. Möller, Seite 80). Schaut man sich die Suchthilfestatistiken der letzten Jahre genau an, suchen die Menschen in aller Regel wegen der Hauptdiagnose Cannabis die Beratungsstellen auf. Diese Personen haben neben ihrer Cannabisproblematik in aller Regel weitere diagnostisch abgrenzbare Krankheitsbilder oder polyvalente Konsummuster. Auch muss berücksichtigt werden, dass ausweislich der deutschen Suchthilfestatistik 2018, (Seite 68 ) 23 % der ambulant behandelten Personen aufgrund von Ratschlägen der Polizei, bzw. Weisungen der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte, die ambulanten Einrichtungen aufsuchten. Hier zeigt sich im Verhältnis zum Alkohol, wo von insgesamt 63.285 behandelten Menschen lediglich 5 % wegen Polizei, Justiz- oder einer Bewährungsauflage ambulant besuchten, ein deutliches Missverhältnis. Soweit kann aus der Erfahrung von 25 Jahren Jugend- und Strafrechtstätigkeit postuliert werden, dass insbesondere viele junge Menschen Beratungsstellen aufsuchen, um lediglich der Bestimmung ihres Richters oder Staatsanwaltes zu folgen. So ist nicht jeder der sich in ambulanter Beratung begeben hat, dort, weil er ein tatsächliches Suchtproblem hat, sondern weil er sich, und das ist auch gut so, lediglich beraten lassen will oder muss. Auch werden viele von ihren Eltern hierzu gedrängt. Ein tatsächlicher Krankheitswert im Sinne einer Cannabissucht dürfte nur den stationär Behandelten zugeschrieben werden. Hierbei ergeben die Zahlen der deutschen Suchthilfestatistik der Jahre 2013 – 2018 maximal eine Personenzahl von 4.000. Stellt man die Zahl 4.000 ins Verhältnis auf eine konservativ geschätzte Gesamtzahl von 4 Millionen Cannabiskonsumenten, so ergibt sich tatsächlich eine durch Cannabis entwickelte Problematik, die zu Krankenhausaufenthalten führt, bei lediglich 0,1 % aller Cannabiskonsumenten. Und diese haben in aller Regel neben der Hauptdiagnose Cannabis weitere Diagnosen. Die Prozentzahl von 0,1 % ist verschwindend gering im Verhältnis zu den regelmäßig in Drogen- und Suchtberichten der Bundesregierung genannten Zahlen bezüglich problembehafteter Cannabiskonsumenten. Hier wird ab dem Jahre 2016 die Zahl von 400000 Fällen genannt. Eine besondere Ausführung, weswegen diese 400000 Menschen ein Cannabisproblem haben, erfolgt in den Drogen und Suchtberichten nicht. Es handelt sich insoweit um bloße Schätzungen, die sich an der Häufigkeit des Konsums von Cannabis orientieren. Hiernach müsste allerdings bereits der derjenige ein Problem haben, der zweimal pro Woche wenig Cannabis zu sich nimmt. Diese Personen haben allerdings keinerlei Probleme sondern man schreibt ihnen diese zu. In diesem Zusammenhang soll noch folgendes erwähnt werden. Während die Drogen- und Suchtberichte noch im Jahre 2015, 600000 problembehaftete Fälle aufführten, sind diese Zahlen seit dem Jahre 2016 ohne Begründung auf 400000 Fälle reduziert. Weswegen bei gleichbleibendem Cannabiskonsum in der Gesellschaft innerhalb eines Jahres 200000 weniger Menschen als problembehaftet angesehen werden, ist nicht nachvollziehbar, zeigt aber wie aus ideologischen Gründen, um der Prohibition weiter das Wort zu reden, mit Zahlen manipulativ umgegangen wird.
Insgesamt kommt das Amtsgericht Bernau unter Berücksichtigung aller zugänglicher Quellen zur sicheren Überzeugung, dass nur für sehr, sehr wenige im Verhältnis zur Gesamtzahl der Cannabiskonsumenten ein tatsächliches Risiko besteht in eine nicht gewollte Suchtmittelabhängigkeit zu geraten.
Ein weiteres wichtiges Argument in der Diskussion um Cannabis ist seine mögliche „Schrittmacherfunktion" für den Einstieg in andere illegale Drogen bzw. den Umstieg auf härtere Substanzen. Diese These von Cannabis als Einstiegsdroge hat das Bundesverfassungsgericht bereits in der Entscheidung vom 09.03.1994 unter Bezugnahme auf den damaligen Wissensstand zurückgewiesen (vgl. BVerfGE 90,145,181 m.w.N ).Auch durch Kleiber/Kovar wird dieser These im Rahmen Ihrer Expertise nochmals ausdrücklich entgegen getreten (vgl. hierzu Möller, S.90 f.; Soellner 2010; Thomasius 2006, S. 126). Sie wird auch in den Suchtberichten der Bundesregierung der vergangenen Jahre nicht mehr genannt.
Die Frage, ob der Konsum von Cannabis ein amotivationales Syndrom hervorruft, das durch Passivität, Interesse- und Motivationsverlust gekennzeichnet ist, nimmt in der Diskussion um die Droge einen besonderen Stellenwert ein. Kleiber/Kovar kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass die These, Cannabiskonsum führe mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu einem amotivationalen Syndrom, nicht belegt werden kann (so auch: Möller, S. 88; Krumdiek, Nicole, Die national- und internationalrechtliche Grundlage der Cannabisprohibition in Deutschland, Bremer Forschungen zur Kriminalpolitik, Band 7, 2006 – im Folgenden zitiert als Krumdiek 2006; Zimmer, Lynn/Morgan, John/Bröckers, Mathias, Cannabis Mythen – Cannabis Fakten: Eine Analyse der wissenschaftlichen Diskussion, 2004, S. 86; Grinspoon, Lester/Bakalar, James, Marihuana, die verbotene Medizin, 1994, S. 176 f.; Kuntz, Helmut, Cannabis ist immer anders. Haschisch und Marihuana: Konsum – Wirkung – Abhängigkeit, 2002, S. 92 f.; Kleiber, Dieter/ Soellner, Renate, Cannabiskonsum. Entwicklungstendenzen, Konsummuster und Risiken, 1998, S. 141, S. 161 – im Folgenden zitiert als Kleiber/ Soellner 1998; Sleator, Alex/ Grahame Allen, Grahame, Cannabis. House of Commons Library Reasearch Paper 00/74, S. 26; Martin/Hall, The health effects of Cannabis: key issues of policy relevance Bulletin on Narcotic, 1999, S. 10; Schwenk, Charles, Marijuana and Job Performance: Comparing the Major Streams of Research, Journal of Drug Issues 1998, S. 941, S. 948; Wheelock, Barbara, Physiological and psychological effects of cannabis: review of the research findings, 2002, S. 46, S. 48; Krausz, Michael/ MeyerThomson, Günter, Cannabis – Wirkmechanismen und Risikopotentiale, in: Cannabis im Straßenverkehr, hrsg. von Berghaus, Günter/ Krüger, Hans-Peter, 1998, S. 44, S. 47 – im Folgenden zitiert als Krausz/ Meyer-Thompson 1998; anders Thomasius 2006, S. 117). So konnte die Symptomatik, die eigentlich dem „amotivationalen Syndrom“ zugeschreiben wird, auch bei Nichtkonsumenten beobachtet werden (Kleiber/Soellner 1998, S. 133; Grotenhermen, Franjo, Fahrtüchtigkeit, Fahreignung und Cannabiskonsum, in: Cannabis, Straßenverkehr und Arbeitswelt, hrsg. von Grotenhermen, Franjo/ Karus, Michael, S. 185). Andererseits sind auch unter den Cannabiskonsumenten Personen zu finden, die extrem leistungsorientiert sind (Kleiber/ Soellner, 1998, S. 132 ff.; Krausz/ Meyer-Thompson 1998, S. 46 f.). Studien, in denen dieses Syndrom beschrieben wird, wurden dagegen zumeist an stark vorbelasteten Stichproben, wie z. B. Psychiatrieklientel, und in unterschiedlichsten Kulturen durchgeführt, ohne unabhängig von der akuten Substanzwirkung bestehende Demotivationsphänomene zu berücksichtigen (vgl. Soellner/Rummel 2008, S. 309).
Es bleibt insoweit noch anzumerken, dass das früher noch benutzte Argument, Cannabis rufe ein Amotivationales Syndrom hervor, heute seitens der Verfechter der Prohibition nur noch von ganz wenigen benutzt wird. Auch die Drogen- und Suchtberichte der Bundesregierung erwähnen diese vermeintliche Folge von Cannabiskonsum jedenfalls seit dem Jahr 2015 nicht mit einem Wort.
ff) Beeinträchtigung der Fahr- und Flugtüchtigkeit
Auch wenn laut den rn des EU-Forschungsprojekts „Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) "THC viel weniger beeinträchtigend und riskant zu sein [scheint] als die meisten anderen untersuchten Stoffe“ (siehe: H. Schulze, M. Schumacher, R. Urmeew, K. Auerbach. „DRUID – Abschlussbericht: Durchgeführte Arbeiten, wichtigste Ergebnisse und Empfehlungen“. EU-Forschungsprojekt „Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) mit Beiträgen von 38 Einrichtungen aus 18 europäischen Ländern, Hauptauftraggeber: Bundesanstalt für Straßenwesen, Deutschland. Oktober 2006 (Projektbeginn) bis August 2012, S. 105, aufrufbar: [folgt eine URL], sind die Fahr- und Flugtüchtigkeit betreffende Leistungseinbußen im Bereich Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen, wie sie im akuten Cannabisrausch auftreten, unbestritten. Signifikante Leistungseinbußen sind vor allem in der ersten Stunde nach Cannabiskonsum beobachtet worden, in Einzelfällen jedoch (in den sehr sensiblen Flugsimulatorstudien) auch noch nach 24 Stunden. Während des Wirkungsmaximums, circa 30 Minuten nach dem Inhalieren, ist die verkehrsrelevante Beeinträchtigung durch THC am größten (vgl.: M. R. Möller. „Drogen im Straßenverkehr – neue Entwicklungen“, 44. Deutscher Verkehrsgerichtstag, Tagungsband S. 172–179. Goslar, 25.–27. Januar 2006), die ab der zweiten Stunde nach Rauschbeginn vollständig ausgeglichen werden können. Automatisierte Leistungen werden länger herabgesetzt und können nicht ausgeglichen werden. Das subjektive Rauscherleben ist häufiger zu beobachten als tatsächliche Leistungseinbußen, auch hält es länger an als die objektiven Beeinträchtigungen (vgl. Kleiber/ SKovar 1997 S.247).
Der Einfluss von THC auf die Fahrtauglichkeit zeigte nach epidemiologischen, experimentellen und meta-analytischen Untersuchungsansätzen eher niedrige Risikoschätzungen, so die Autoren der europaweiten DRUID-Studie, die davon ausgehen, dass eine „Serumkonzentration von 3,8ng/ml THC (≈2ng/ml im Vollblut) dieselben Wirkungen verursacht wie 0,5g/l Alkohol“ (siehe: H. Schulze, M. Schumacher, R. Urmeew, K. Auerbach. „DRUID – Abschlussbericht: Durchgeführte Arbeiten, wichtigste Ergebnisse und Empfehlungen“. EU-Forschungsprojekt „Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) mit Beiträgen von 38 Einrichtungen aus 18 europäischen Ländern, Hauptauftraggeber: Bundesanstalt für Straßenwesen, Deutschland. Oktober 2006 (Projektbeginn) bis August 2012, S. 105, aufrufbar: [folgt eine URL]). Der Wert von 2ng/ml im Vollblut könnte, anstatt des aktuell herrschenden Grenzwertes von 1ng/ml Vollblut, eine empirisch fundierte Basis für die Diskussion für die Erhöhung des Grenzwerts für Cannabis sein, so die Forscher in ihrem Fazit (vgl. ebd.).
gg) Cannabis und andere Stoffe im Vergleich
Auch hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis im Vergleich zu sonstigen illegalen und legalen Stoffen sind signifikante neue Ergebnisse zu verzeichnen. Dass das Gefährdungspotenzial, welches vom Cannabis ausgeht, deutlich hinter dem des Alkohols bzw. Nikotins zurücksteht, wird schon dadurch deutlich, dass jährlich 110.000 bis 140.000 Todesfälle (Thamm, Michael/ Junge, Burckhard, Tabak, in: Jahrbuch Sucht 2004, hrsg. von Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), 2004, S. 57 f.) zu verzeichnen sind, die in Verbindung mit Tabak stehen. Durch Alkohol sterben weltweit jedes Jahr rund drei Millionen Menschen (vgl. hierzu Ärzteblatt, Drei Millionen Todesfälle jährlich, 21.09.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL]/). Dagegen sind Todesfälle, welche auf Cannabiskonsum zurückzuführen sind, nicht bekannt (s. o., sowie Möller, S.76 m.w.N.).
Auch die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung e.V. vertritt in einer Stellungnahme zur Legalisierungsdebatte des nicht-medizinischen Cannabiskonsums die Auffassung, dass eine Ungleichbehandlung von Cannabis im Vergleich zu legalen Stoffen nicht zu rechtfertigen sei, da Alkohol und Tabak als wesentlich gefährlicher eingestuft werden müssen (Rumpf, Hans Jürgen/ Hoch, Eva, Thomasius, Rainer u. a., Stellungnahme zur Legalisierungsdebatte des nicht-medizinischen Cannabiskonsums, in: Blutalkohol 2015, S. 329 ff.). Eine Studie der Universität Maastricht und der Goethe Universität Frankfurt aus Januar 2016 bestätigt, dass Cannabis – im krassen Gegensatz zu Alkohol – Aggressionen bei den Konsumenten reduziert, statt steigert (De Sousa Fernandez Perna/ Theunissen/ Kuypers/ Toennes/ Ramaekers, Subjective aggression during alcohol and cannabis intoxication before and after aggression exposure, 2016: abrufbar unter [folgt eine URL] vgl. hierzu auch Möller, S. 121).
Zum gleichen Ergebnis kommt Dr. med. Carl Nedelmann, der die Auffassung vertritt, dass die von Cannabis ausgehenden Gefahren geringer seien als die der legalen Drogen Alkohol und Nikotin (Nedelmann, Carl, Drogenpolitik: Das Verbot von Cannabis ist ein „kollektiver Irrweg“, abrufbar unter: [folgt eine URL]; Er führt hierzu zusammenfassend aus: „Die medizinischen Argumente, die zur Aufrechterhaltung des Cannabis-Verbotes verwendet worden sind, stammen aus Befunden schwerer Pathologie. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Schäden, die Alkohol anrichtet, schwer, häufig und anhaltend sind; Schäden, die Cannabis anrichtet, sind leicht, selten und flüchtig. Aus medizinischer Sicht wird kein Schaden angerichtet, wenn Cannabis vom Verbot befreit wird. Das Cannabis-Verbot kann durch medizinische Argumente nicht gestützt werden“ (vgl. Nedelmann, [folgt eine URL].
Das britische Independent Scientific Committee on Drugs kam bei einer Vergleichsstudie zum potenziellen Schädigungsgrad verschiedener illegaler Substanzen zu folgendem Ergebnis (vgl. [folgt eine URL]):
| Droge | Schädigungsgrad |
| Alkohol | 72 |
| Heroin | 55 |
| Crack-Kokain | 54 |
| Metamphetamine | 33 |
| Kokain | 27 |
| Tabak | 26 |
| Amphetamine | 23 |
| Cannabis | 20 |
hh) Abweichende Stimmen
Trotz der oben bereits ausgeführten Erkenntnisse gibt es nach wie vor wichtige Stimmen in Gesellschaft und Politik, die das Betäubungsmittel Cannabis und die Folgen des Konsums für die Menschen als so gefährlich erachten, dass man deswegen Millionen von Menschen kriminalisieren dürfte. So finden sich in der deutschen Parteienlandschaft noch 2 Parteien, die eine unbedingte Cannabisprohibition das Wort reden. Zunächst einmal die CDU, die allerdings langsam aber sicher auch Stimmen in ihren eigenen Reihen hat, die sich für eine Legalisierung einsetzen. So insbesondere Kreisverbände der Jungen Union und Haushaltspolitiker. Auch die AfD setzt sich in ihrer Gesamtheit für die weitere umfassende Strafverfolgung ein. Schließlich noch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die nach wie vor weder eine Liberalisierung noch eine Legalisierung von Cannabis befürwortet. Alle zuvor genannten wie auch weitere nicht genannte Prohibitionisten argumentieren im Wesentlichen mit den Argumenten, die letztlich zum Cannabisverbot geführt haben. So argumentieren sie wiederholt und immer noch mit der bereits widerlegten Einstiegsdrogentheorie. Dies obwohl sämtliche Wissenschaftler weltweit, wie auch das Bundesverfassungsgericht 1994 der Auffassung sind, das Cannabis eben keine Einstiegsdroge ist. Es wird weiter mit der Volksgesundheit argumentiert, und zwar in Unkenntnis oder aus parteipolitischen Gründen. Es wird ausgeblendet, dass durch die bisherige Kriminalisierung und unter Berücksichtigung eines internationalen Vergleichs, die Kriminalisierung keinerlei Auswirkungen auf die Verbreitung des Betäubungsmittels Cannabis hat. Ferner wird immer wieder mit dem Jugendschutz argumentiert. Dies obwohl keiner der Menschen, die sich für eine Legalisierung einsetzen, eine Abgabe an Jugendliche befürwortet und auch die Gefahren bezüglich des insbesondere regelmäßigen Dauerkonsum sehen. Vielmehr wollen die Menschen, die sich für eine Legalisierung aussprechen, in Kenntnis des Umstandes, dass Jugendliche und Kinder geschützt werden müssen, ja gerade eine bessere und vor allen Dingen von Strafrecht freien Gesetzeslage. Sie möchten eine vernünftige Prävention – und Aufklärungsarbeit.
Nach dem mittlerweile die überwiegende Parteienlandschaft sich für eine Legalisierung oder zumindest Entkriminalisierung ausspricht und das Argument der Einstiegsdroge nicht mehr gebracht werden kann, erklären die Prohibitionisten nun, das Cannabis deswegen gefährlich sein kann, weil es Psychosen auslösen würde. Aber auch diesem Argument fehlt jegliche wissenschaftliche Grundlage. Insoweit kann der Unterzeichner dieser Vorlage mitteilen, dass er in seiner 25 jährigen Geschichte als Jugend - und Strafrichter sehr wohl Menschen mit Psychosen vor sich hatte, die auch regelmäßig und viel zu viel das Betäubungsmittel Cannabis konsumiert haben. Allerdings haben diese Personen es trotz der bestehenden strafrechtlichen Verfolgung gemacht und hätten sehr viel früher bei einem offenen und ehrlichen Umgang behandelt werden können. Und obwohl keine tatsächliche Expertise vorliegt, wird weiterhin das Argument von der Psychose bemüht. Und nach dem auch dieses quasi in den letzten 20 Jahren neu geschaffener Argument nicht mehr fruchtet hat man hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis eine weitere Argumentationsgrundlage gesucht und sie in den Wirkstoffgehalten des Cannabis gefunden. Diese Wirkstoffgehalte (THC) seien mittlerweile so hoch, dass sie hoch gefährlich seien. Deswegen müsse man Cannabisgebrauch weiter kriminalisieren. Aus eigener Sachkunde heraus kann dazu nur mitgeteilt werden, dass es bereits in den 70 Jahren Cannabis in Form von Haschisch (Cannabisharz) gegeben hat, das Wirkstoffgehalte bis zu 30 % an THC aufwies. Auch hat das heute bundesweit durch Ärzte nach dem Cannabismedizingesetz verschriebene Medizinalcannabis THC-Gehalte von über 20 %. Wenn Marihuana heute höhere THC-Gehalte aufweisen als noch vor 30 Jahren, so führt dies nicht dazu, dass deswegen die Einnahme von Cannabis gefährlicher ist als vorher. Denn die Konsumenten von Cannabis wissen in aller Regel mit dem Betäubungsmittel Cannabis sachgemäß umzugehen. Bei höheren THC-Gehalten konsumieren sie eben von dem von ihnen erlangten Cannabis weniger; analog der Patienten, die durch ihre Ärzte mit hohen THC Gehalten an Cannabis ausgestattet werden.
Die gesamte Argumentation der Legalisierungsgegner wird mit nicht nachvollziehbaren Argumenten oftmals mit falschen Zahlen (siehe oben) und mit der Angst der Bürger vor dem Unbekannten geführt. Die Argumentation ist nicht wissenschaftlich fundiert und dient letztendlich lediglich dem Zweck an der Kriminalisierung Millionen von Menschen als Minderheit festzuhalten. Soweit insbesondere das Gesundheitsministerium des Bundes und auch die Drogenbeauftragte des Bundes argumentieren, argumentieren sie oft im luftleeren Raum. Und dies, obwohl das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber im Jahre 1994 aufgegeben hatte, jederzeit zu prüfen, ob die Kriminalisierung noch zeitgemäß ist. So führte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 09.03.1994 wortwörtlich aus:
| „Angesichts der dargestellten offenen kriminal-politischen und wissenschaftlichen Diskussionen über die von Cannabiskonsum ausgehender Gefahr und den richtigen Weg ihrer Bekämpfung hat der Gesetzgeber die Auswirkungen des geltenden Rechts unter Einschluss der Erfahrung des Auslands zu beobachten und zu überprüfen. Dabei wird er insbesondere einzuschätzen haben, ob und in wieweit die Freigabe von Cannabis zu einer Trennung der Drogenmärkte führen und damit zur Eindämmung des Betäubungsmittelkonsums insgesamt beitragen kann oder ob umgekehrt nur die strafbewehrte Gegenwehr gegen den Drogenmarkt insgesamt und die sie bestimmende organisierte Kriminalität hinreichenden Erfolg verspricht“. (vgl. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 90, 145, 194). |
Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat es eine einzige Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit über die Auswirkungen des Cannabiskonsums gegeben. Diese Studie wurde im Jahre 1997 fertig gestellt und auch in dieser Vorlage wiederholt zitiert. Entgegen der Gepflogenheiten wurde diese Studie nicht in die öffentliche Schriftenreihe des Bundesministeriums aufgenommen, da sie im Ergebnis den Betäubungsmittel Cannabis eine im Verhältnis zu noch angedachter Gefährlichkeit in den 70 Jahren eine wesentliche geringere Gefährlichkeit zuschrieb. Hiernach hat das Bundesministerium für Gesundheit im Jahre 2006 und im Jahre 2017 zwei weitere Studien in Auftrag gegeben, die allerdings keinerlei eigene Forschungen beinhalteten. Zunächst eine Expertise zu gesundheitlichen und psycho-sozialen Folgen unter dem Titel Auswirkung von Cannabiskonsum – Missbrauch durch Dr. Uwe Petersen und Prof. Dr. Thomasius. Federführend hierbei war Prof. Dr. Thomasius, der bereits bei Auftragserteilung anerkannter Legalisierungsgegner gewesen ist. Eigene Forschungen beinhaltete die Forschungsarbeit nicht. Es wurde lediglich eine systematische Review der international-publizierten Studien von 1996 bis zum Jahre 2006 durchgeführt. Die Zusammenfassung dieser Arbeit wird allgemein gehalten und weist insbesondere keine konkreten Zahlen an tatsächlich Gefährdeten oder in stationärer Behandlung gewesenen Personen auf. Auch die sodann 2017 in Auftrag gegebene wissenschaftliche Bestandsaufnahme unter dem Titel Cannabis, hier zitiert als Capris-Studie hat lediglich eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme zum Inhalt gehabt. Auch diese Studie hat keine eigenen Forschungsergebnisse präsentieren können. Den beiden Studien ist zu eigen, dass sie sinngemäß mit Begriffen arbeiten wie möglicherweise, kann eventuell , es wird vertreten, es ist nicht auszuschließen, es besteht die Gefahr, oder es wurde nicht erforscht. In der Petersen/Thomasius Studie, und das ist hervorzuheben, werden die besonderen Verdienste von Kleiber und Kovar bezüglich der Entkräftung vieler dramatisierenden Auffassungen zu den Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum wortwörtlich gelobt (vgl. Petersen/ Thomasius a.a.O. Seite 162 ). Allerdings kommen die Autoren zu den weiteren Ergbnis, dass bezüglich von psychischen und neukognitiven Auswirkungen des Cannabiskonsums insbesondere bei adoleszenten Konsum sinngemäß eine andere Gefährlichkeit bestehen würde.
Beide Studien führten dazu, an der Kriminalisierung festhalten zu können und die Argumente, die zur Prohibition geführt haben, zu stützen. Hierauf kann allerdings zur Auffassung des Gerichts in Kenntnis der tatsächlichen Zahlen (siehe oben) eine Gefährlichkeit des Cannabiskonsums, die die Kriminalisierung rechtfertigen könnte, nicht gestützt werden. Zur Auffassung des Gerichts ist das Bundesministerium für Gesundheit seiner ihm durch das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1994 aufgetragenen Prüfpflicht insbesondere hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis nicht nachgekommen. Auch hat das Bundesministerium für Gesundheit wiederum entgegen der auferlegten Prüfpflicht die internationalen Entwicklungen völlig außer Acht gelassen. Hierbei hätte es bereits genügt in das Nachbarland Niederlande zu schauen, um festzustellen, dass bei einer Liberalisierung wie nachfolgend dargestellt, nicht mehr oder weniger Menschen zum Betäubungsmittel Cannabis greifen (vgl. unten S.45). Man hätte auch darüber hinaus feststellen können, dass in den Niederlanden nicht mehr oder weniger Menschen mit dem Betäubungsmittel Cannabis ein Problem haben und das es völlig egal ist, ob die Droge freigegeben wird oder aber wie in Deutschland durch einen untauglichen Versuch der Kriminalisierung begrenzt werden soll.
Im Ergebnis kommt das Amtsgericht Bernau bei Berlin zu der festen Überzeugung, dass der Gesetzgeber seiner ihm auferlegten Prüfpflicht nicht nachgekommen ist und letztendlich aus ideologischen Gründen und ohne tatsächlich belastbares Material die Kriminalisierung von Millionen von Menschen aufrechterhalten will. Wirkliche Argumente stehen dem Gesetzgeber nicht mehr zur Verfügung.
ii) Zusammenfassung
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden: Der Konsum von Cannabis kann bei chronischem Konsum und Konsum im jungen Alter sowohl geringe physische als auch psychischen Auswirkungen haben. Soweit ein akuter Rauschzustand erfolgt und hierdurch positive und bisweilen vorübergehend mal negative Folgen durch Cannabiskonsum auftreten, sind diese seitens der Konsumenten gewollt bzw.in Kauf genommen. Jedoch hat sich insgesamt betrachtet – wie gezeigt – die Bewertung der Gefährlichkeit dieser Auswirkungen für den Einzelnen sowie für die Allgemeinheit verändert. So kann heute als wissenschaftlich hinreichend gesichert angesehen werden, dass der von der überwiegenden Mehrheit der Konsumenten betriebene moderate Konsum von Cannabis – insbesondere im Vergleich zu anderen, derzeit als ungefährlicher oder gleich bewerteten Substanzen, wie etwa Alkohol, Tabak oder Opioiden – als relativ ungefährlich angesehen werden muss (so auch Möller, 245). Dies wird durch vielfache nationale und internationale Fachstudien belegt. Ebenfalls außer Frage steht, dass besondere Risikofaktoren wie Konsum im Jugendalter, Dauerkonsum, Konsum im Straßenverkehr oder Konsum von Cannabis mit hohem THCGehalt angemessen kontrolliert und reguliert werden müssen.
Schließlich wurden die Erkenntnisse zu Wirkung und Anwendungsgebiete von Cannabis im medizinischen Bereich nunmehr – jedenfalls bedingt – auch durch den deutschen Gesetzgeber anerkannt.
Neben den soeben aufgezeigten Entwicklungen im Bereich der Cannabisforschung und medizinischen Cannabislegalisierung gibt es insbesondere auf internationaler Ebene weitreichende politische, soziologische sowie rechtliche Entwicklungen, die eine Neubewertung der Cannabispflanze, des gesellschaftlichen und rechtlichen Umgangs mit ihr sowie insbesondere auch einen effektiven Schutz im Hinblick auf die bestehenden Risikofaktoren des Cannabiskonsums erforderlich machen.
3 b) Cannabis als Medizin
Neben der Neueinordnung der Gefährlichkeit des Konsums von Cannabis im Freizeitbereich und im rekreativen Bereich liegt eine wesentliche Neuerung im Hinblick auf die Entscheidung aus 1994 in der immensen Ausweitung der Anwendung von Cannabis in der Heilbehandlung – insbesondere auch in der therapeutischen und ärztlich nicht begleiteten Selbstmedikamentation.
aa) Medizinische Anwendung
Cannabis wird seit geraumer Zeit als Medikament gegen chronische Schmerzen, Nervenschmerzen, spastische Schmerzen, bei Multipler Sklerose oder Rheumaleiden, zur Appetitsteigerung bei Krebs und Aids eingesetzt (vgl. hierzu exemplarisch [folgt eine URL]. Der medizinische Nutzen von Cannabis wurde auch bereits in der Expertise von Kleiber/Kovar 1997 ausführlich dargelegt (vgl. hierzu auch ausführlich WHO, Critical Review 2018, Section 4).
Am 13.02.2019 wurde die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von Cannabis in der Medizin (Res. 2018/2775 (RSP)) angenommen.
Dort wird durch das europäische Parlament konstatiert, dass es nach heutigem Stand der Wissenschaft überzeugende Beweise dafür gibt, dass Cannabis und Cannabinoide eine therapeutische Wirkung haben und beispielsweise zur Behandlung chronischer Schmerzen bei Erwachsenen (z. B. im Rahmen von Krebserkrankungen), als Mittel gegen Übelkeit zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen aufgrund einer Chemotherapie oder zur Linderung der von Patienten erwähnten spastischen Lähmung aufgrund von multipler Sklerose eingesetzt werden können. Darüber hinaus findet Cannabis Verwendung bei der Behandlung von Patienten mit Angststörungen, PTBS und Depression . Weiterhin gibt es Beweise dafür, dass Cannabis oder Cannabinoide im Zusammenhang mit HIV/Aids den Appetit anregen oder den Gewichtsverlust verringern, die Symptome von psychischen Störungen wie Psychosen, dem Tourette-Syndrom und von Epilepsie, Alzheimer, Arthritis, Asthma, Krebs, Morbus Crohn und Grünem Star lindern, zur Verringerung des Risikos von Adipositas und Diabetes beitragen sowie Menstruationsbeschwerden lindern können (vgl. Punkt L und M der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von Cannabis in der Medizin (Res. 2018/2775 (RSP)).
Ziel dieser Erwägung ist es zum einen, einheitliche Begrifflichkeiten im Hinblick auf medizinisches Cannabis zu entwickeln, zum anderen, durch Finanzierung und Initiative umfangreiche Forschungsprogramme zu fördern und so weitere Erkenntnisse in diesem Bereich zu generieren sowie die erforderlichen Bedingungen für eine verantwortliche Handhabung von Cannabis als Medizin zu gewährleisten. Zu diesem Zweck fordert die Kommission die Mitgliedstaaten u. a. auf, die regulatorischen, finanziellen und kulturellen Hindernisse zu beseitigen, vor denen die wissenschaftliche Forschung im Bereich Cannabis steht. Betont wird zudem die Erforderlichkeit einer engen Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Weiter werden die Mitgliedstaaten explizit dazu aufgefordert, für die Verfügbarkeit von Arzneimitteln auf Cannabisbasis in ausreichender Menge zu sorgen, damit der tatsächliche Bedarf gedeckt ist.
bb) Gesetzliche Neuregelung
Als Konsequenz der dargestellten Entwicklungen wurde die medizinische Nutzung von Cannabis in Deutschland durch das am 10.03.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (BGBl 2017, Teil I, Nr.11, S.403) für Schwerkranke teillegalisiert. Als Ziel des Gesetzes wurde durch die Bundesregierung vorgegeben:
| „Dieses Gesetz dient dazu, die Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit von weiteren Cannabisarzneimitteln herzustellen, wie z. B. von getrockneten Cannabisblüten und Cannabisextrakten in standardisierter Qualität. Damit soll Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen nach entsprechender Indikationsstellung und bei fehlenden Therapiealternativen ermöglicht werden, diese Arzneimittel zu therapeutischen Zwecken in standardisierter Qualität durch Abgabe in Apotheken zu erhalten. Zu diesem Zweck wird eine Cannabis-Agentur eingerichtet, welche Herstellung und Vertrieb regelt“ (vgl. BT-Drucks. 18/8965 S. 1). |
In der Presseerklärung des Bundesministeriums für Gesundheit äußert sich Staatssekretärin Ingrid Fischbach insofern wie folgt:
| „Bei schweren Erkrankungen wie chronischen Schmerzen oder Multiple Sklerose kann Cannabis als Medizin helfen, Symptome zu lindern. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass künftig Patientinnen und Patienten Cannabis in Arzneimittelqualität durch die Gesetzliche Krankenversicherung erstattet bekommen können, wenn es medizinisch angezeigt ist. […]“ |
Die gesetzlichen Neuregelungen bedeuten u. a. anderem, dass nunmehr neben Fertigarzneimitteln auf Cannabisbasis auch getrocknete Cannabisblüten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, wenn diese zu Therapiezwecken notwendig sind. Zur Versorgung der Patienten soll ab 2020 auch der Anbau von Medizinalhanf in Deutschland starten. Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) rechnet nach der Vergabe der Anbaulizenzen an drei Unternehmen mit der ersten Cannabisernte Ende des kommenden Jahres [folgt eime URL]. Aktuell leiden Patienten noch immer unter vermehrten Lieferengpässen [folgt eine URL] (vgl. hierzu auch Möller, S. 235).
Obwohl die Anwendungsfälle für medizinisches Cannabis auch nach der gesetzlichen Neuregelung noch sehr limitiert und reglementiert sind, steigt seit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Zahl der Menschen, welche Cannabis als Medizin verordnet bekommen, stetig an. Über die genauen Zahlen der Cannabispatienten wird derzeit zwar keine nationale Statistik geführt, im September 2018 wurde die Zahl jedoch bereits auf über 40.000 Patienten geschätzt (vgl. hierzu Telgheder, immer mehr Schmerzpatienten bekommen Marihuana auf Rezept, Handelsblatt-online vom 28.09.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL] . Im Jahr 2018 wurden 142.000 Kassenrezepte ausgestellt. Der Altersdurchschnitt der Patienten mit Cannabisverordnungen liegt bei 55 Jahren. Im dritten Quartal 2018 erzielten Cannabisblüten und cannabishaltige Zubereitungen ohne Fertigarzneimittel einen Umsatz von mehr als 17 Millionen Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. Ärzteblatt, Umsatz mit medizinischem Cannabis steigt, Hausärzte beurteilen Therapie zwiespältig, vom 13.12.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Gleichzeitig werden jedoch etwa ein Drittel der gestellten Anträge auf Kostenerstattung von den gesetzlichen Krankenkassen abgelehnt (vgl. hierzu Telgheder, Immer mehr deutsche Patienten bekommen Cannabis auf Rezept, Handelsblatt Online vom 06.02.2019 [folgt eine URL].
Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass die Kosten für die Krankenkassen zwischenzeitlich bei über 100 Millionen € liegen (vgl. Bundestagsdrucksache 19/17363 ). Im Rahmen einer Freigabe von Cannabis und zeitgleicher Erlaubnis eines Eigenanbaus könnten diese Kosten sicherlich um weit mehr als die Hälfte reduziert werden. Zur Kenntnis des Gerichts wären sehr, sehr viele Patienten in der Lage ihre benötigten Rationen an Medizinalcannabis eigenständig und für ihre Krankheit passend selber anzubauen. Das verbietet aber der Gesetzgeber.
c) Internationale Entwicklungen
Mehrere Länder weltweit haben seit 2014 den Cannabismarkt reguliert, d. h. dem illegalen Markt einen legalen gegenübergestellt, der den illegalen dauerhaft verdrängen soll. Die nachfolgend skizzierten Entwicklungen befassen sich mit der Art und Weise der Regulierung sowie, soweit vorhanden, mit den Entwicklungen des Cannabiskonsums insgesamt und insbesondere bei Jugendlichen und Heranwachsenden sowie den Entwicklungen auf dem Drogenmarkt. Die Betrachtung der internationalen Entwicklung ist für die nationalverfassungsrechtliche Frage der Eignung des strafbaren Verbots des Umgangs mit Cannabis, insbesondere des Besitzes auch nicht geringer Mengen, zur Erreichung der gesetzgeberischen Ziele, hier des Schutzes der Volksgesundheit, des Straßenverkehrs, der Jugend und der Verhinderung der kriminellen Folgeerscheinungen des Drogenmarktes, von erheblicher Bedeutung. Vor dem Hintergrund der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom 09.03.1994, wonach ein grundrechtseinschränkendes Gesetz geeignet ist, wenn mit seiner Hilfe der erstrebte Erfolg gefördert werden kann und erforderlich ist, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte wählen können, bedarf es einer Befassung mit der Frage, ob die Regulierung den gesetzgeberisch gewünschten Erfolg nicht effektiver erreichen kann (siehe auch Möller, Kapitel E. Alternative Strategien, S. 195 ff., 229 ff.).
Vor dem Hintergrund, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 09.03.1994 bei dem damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand es vor allem aus gesundheitspolitischen Gründen nicht für vertretbar erachtete, Cannabis aus dem Kontrollsystem des Opiumgesetzes zu entlassen und es als Massengenussmittel für den freien Verkehr zuzulassen, wie dies verschiedentlich gefordert wurde, ist die Befassung mit Regulationsmodellen anderer Länder bedeutsam. 1994 war es die Sorge des Bundesverfassungsgerichts, dass „als Folge einer solchen Freigabe mit Sicherheit einsetzende Werbung“ … „den Massenkonsum der Droge bis zu einem solchen Ausmaß anheizen“ würde, „daß auch die letzten ihrer psychischen Veranlagung wegen besonders drogengefährdeten Menschen erreicht würden“ und dass der „Schaden, der mit der ,Integration‘ dieser Droge für die Allgemeinheit verbunden wäre“, sich bei der damaligen „unsicheren Erkenntnislage nicht hinreichend im Voraus berechnen“ ließ, „aber überschlägig als sehr hoch“ veranschlagt wurde (BVerfG vom 09.03.1994 – 2 BvR 2031/92 – Rn. 132). Diese Sorge hat sich, betrachtet man die jüngsten Regulationsmodelle verschiedener Staaten, als unbegründet erwiesen.
aa) Entwicklungen in den USA – Colorado, Washington State, Alaska, Oregon, Kalifornien
In den USA ist der Verkauf von Cannabis an Erwachsene in folgenden Staaten legalisiert oder entkriminalisiert:
- Colorado seit 06.11.2012
- Washington seit 06.11.2012
- Alaska seit 04.11.2014
- Oregon seit 04.11.2014
- Washington D.C. seit 04.11.2014
- Kalifornien seit 08.11.2016
- Nevada seit 08.11.2016
- Massachusetts seit 08.11.2016
- Maine seit 08.11.2016
- Vermont seit Januar 2018
- Michigan seit 06.11.2018
- Illinois seit Juni 2019
In Kalifornien führte 1996 ein Volksbegehren zur Legalisierung von Cannabis zum medizinischen Gebrauch. Andere Bundesstaaten folgten nach kurzer Zeit: Washington, Alaska und Oregon 1998, Maine 1999, Colorado, Nevada und Hawaii 2000. Die Entwicklung hat sich fortgesetzt: Inzwischen gelten in 24 Bundesstaaten (Möller spricht von 29 Bundesstaaten, S. 154) sowie in Washington DC gesetzliche Bestimmungen zum medizinischen Gebrauch von Cannabis. Allein in Colorado wurden 2009 mehrere zehntausend Personen gezählt, die ein Rezept für Cannabis zum medizinischen Gebrauch besaßen. Rund 1000 spezialisierte Abgabestellen verkauften die Substanz ohne staatliche Regulierung. 2009 ließ das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) verlauten, es sehe keine Veranlassung mehr, auf dem Cannabismarkt jener Bundesstaaten zu intervenieren, welche eine eigene Regelung für den medizinischen Gebrauch von Cannabis eingeführt hatten. Voraussetzung war, dass dort Vorkehrungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erarbeitet und durchgesetzt würden (vgl. hierzu: Zobel, Frank/Marthaler, Marc, Neue Entwicklungen in der Regulierung des Cannabismarktes – Von A (Anchorage) bis Z (Zürich), 2016, nachfolgend zitiert als Zobel/Marthaler 2016).
Parallel zum medizinischen Gebrauch wuchs die Nachfrage nach medizinischem Cannabis zum „rekreativen“ Gebrauch. Volksinitiativen in Washington State und Colorado stimmten in den Jahren 2012 für die Legalisierung von Cannabis auch für diese Nutzer. Das Bundesjustizministerium verzichtete im August 2013 offiziell, in jenen Staaten zu intervenieren, wenn dort Vorkehrungen zum Schutz der Jugend und vor dem Export in andere Bundesstaaten getroffen werden. Die beiden Pionierstaaten des medizinischen Cannabisgebrauchs, Kalifornien und Washington State, führten 2015 Maßnahmen zur Marktregulierung für den „rekreativen“ Gebrauch ein (Zobel/Marthaler 2016, S. 10).
Am 01.01.2014 trat im US-Bundesstaat Colorado der freie Verkauf von Cannabisprodukten in Kraft. Wenige Monate später sprachen sich Alaska und Oregon für eine gesetzliche Regulierung des legalen Cannabisverkaufs aus. Die bisherigen 300 Abgabestellen für medizinisches Cannabis in Oregon boten die Substanz seit Oktober 2015 im freien Verkauf an. In Alaska wurden im Frühling 2016 die ersten Lizenzen vergeben. Auch in Washington DC, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, wurden Anbau und Besitz von Cannabis zum persönlichen Gebrauch von 64 Prozent der Stimmbürger gutgeheißen. Die Veränderungsprozesse in der Cannabispolitik der Vereinigten Staaten schlagen sich auch in den Umfrageergebnissen nieder, denn heute befürwortet dort die Mehrzahl der Bevölkerung eine Legalisierung von Cannabis. Auch die New York Times forderte 2016 ein Ende der Prohibition der Substanz und empfahl einen regulierten Markt (Einzelnachweise bei Zobel/Marthaler 2016, S. 9 ff.).
Die verschiedenen Cannabis-Regulierungsmodelle der US-Bundesstaaten zeigen viele Gemeinsamkeiten, aber auch etliche Unterschiede. Allen Märkten ist gemein, dass sie auf einem gewinnorientierten Ansatz fußen. Als Vorbild für die Regulierung gilt der Handel mit alkoholischen Getränken. Nur sind die Bestimmungen beim Cannabis enger gefasst, denn schließlich ist diese Substanz auf Bundesebene sowie im internationalen Umfeld immer noch verboten. Frei verkäufliches Cannabis ist Personen ab einem Mindestalter von 21 Jahren zugänglich. Diese dürfen die Substanz besitzen und sie in spezialisierten Geschäften kaufen. Dabei gilt eine Beschränkung der Menge, die bis zu einer Unze (28,4 Gramm) betragen kann. Bisher hat nur Colorado Einschränkungen für die auswärtige Käuferschaft eingeführt. Personen aus anderen Staaten können in Colorado maximal eine Viertelunze (7,1 Gramm) kaufen. Im Bundesstaat Washington dürfen Cannabispflanzen nur zum medizinischen Gebrauch selbst angebaut werden; die anderen Staaten tolerieren den Selbstanbau für den Eigenkonsum. Die erlaubte Menge beträgt je nach Gesetzgebung drei bis sechs Pflanzen pro Person (Einzelnachweise bei Zobel/Marthaler 2016, S. 11).
Fachbehörden sind für die Genehmigung, den Entzug oder die Erneuerung der Lizenzen zuständig. Diese sind auch für die Regulierung und Kontrolle des Cannabismarktes verantwortlich. Auch die örtlichen Behörden der Verwaltungsbezirke (Countys) und Gemeinden können grundsätzlich den Handel mit Cannabis auf ihrem Hoheitsgebiet untersagen oder einschränken, was bereits zu einigen Verboten oder starken Einschränkungen des Cannabishandels genutzt wurde.
In allen Bundesstaaten gilt ein System der Rückverfolgbarkeit (traceability) „vom Samenkorn bis zum Konsumenten“, damit keine Ware unbemerkt in den Schwarzmarkt abfließen kann. Die Kontrollmaßnahmen umfassen auch die Videoüberwachung der Produktionsstätten rund um die Uhr, den Einsatz von Wachleuten sowie Alarmanlagen. Werbung für Cannabisprodukte ist sowohl in Colorado als auch im Staat Washington eingeschränkt (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 12 m. w. N.).
Cannabis wird normalerweise in Verpackungen angeboten, die nicht von Kindern geöffnet werden können. Zudem muss die Ware mit einem amtlichen Etikett gekennzeichnet sein, das folgende Informationen enthält: THC-Gehalt, verwendete Schädlingsbekämpfungsmittel, Warnung vor der gesundheitsschädigenden Wirkung, Bestimmungen zum Jugendschutz (Zobel Marthaler 2016, ebenda).
Die Steuern halten den Preis von Cannabisprodukten auf einem verhältnismäßig hohen Stand, was durchaus einen Einfluss auf das Konsumverhalten zur Folge hat. Im Bundesstaat Washington gelten die höchsten Steuern, denn sie betragen rund 50 Prozent des unversteuerten Produktpreises. In Colorado beträgt der Aufschlag auf den unversteuerten Preis 20 bis 30 Prozent. Oregon erhebt vorübergehend eine Abgabe von 25 Prozent, aber mittelfristig soll diese Gebühr bei rund 20 Prozent festgelegt werden. In Alaska erfolgt die Besteuerung nach Gewicht: Pro Unze wurde ein Betrag von 50 US-Dollar angesetzt (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 13 m. w. N.).
In Colorado betrugen die Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf im Steuerjahr 2014/2015 rund 78 Millionen US-Dollar. In der Periode 2015 bis 2016 sollte der Steuerertrag mindestens 120 Millionen US-Dollar erreichen. Der Bundesstaat Washington hat 2014 bis 2015 rund 80 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Voranschlag für 2015 und 2016 beträgt 200 Millionen US-Dollar. Diese Erträge stellen derzeit rund 1 Prozent der Einnahmen dieser Bundesstaaten dar. Der Cannabismarkt befindet sich in einem raschen Wachstum. Man rechnet, dass das Steueraufkommen aus dem Cannabismarkt in den nächsten Jahren – bei gleichbleibenden Tarifen – die Erträge aus der Alkohol- und Tabaksteuer übertreffen wird. Überdies lassen die Beschäftigungszahlen vermuten, dass der freie Verkauf von Cannabis schon heute zehntausende neuer Arbeitsplätze geschaffen hat (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 13). Stand Februar 2019 wird für Colorado der Umsatz mit Cannabis und Cannabisprodukten seit 2014 auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt (vgl. [folgt eine URL]).
Es gibt eine zweite Erkenntnis, die man aus den Erhebungen ableiten kann: Rechnet man in den regulierten Märkten den Umsatz des legalen Handels mit dem Erlös aus dem Verkauf für den medizinischen Gebrauch zusammen, ergibt sich ein Gesamtvolumen, welches geeignet scheint, dem Schwarzmarkt den größten Teil der Kundschaft zu entziehen. Eine Studie ging davon aus, dass vor der Regulierung des freien Cannabisverkaufs allein in Colorado 130 Tonnen Cannabis konsumiert wurden (Einzelnachweise bei Zobel/Marthaler 2016, S. 13 f. m. w. N.).
Die Preise für freiverkäufliches Cannabis liegen mit 10 bis 12 US-Dollar pro Gramm über dem Schwarzmarktpreis. Nach der Liberalisierung waren die Kosten vorerst gesunken, aber sie haben sich inzwischen auf einem gewissen Stand eingependelt. Offenbar sind die Herstellungskosten wegen der behördlichen Auflagen recht hoch (Steuer, Lizenzgebühren, Überwachungsmaßnahmen, Ausbildung usw.). Aus diesem Grund kann legal produziertes Cannabis womöglich nicht zu günstigen Preisen angeboten werden, und dies, obwohl Cannabis sehr kostengünstig produziert werden kann. Es wird geschätzt, dass der Herstellungsaufwand mit jenem eines Teebeutels vergleichbar ist (so Zobel/Marthaler 2016, S. 14).
Bereits vor der Regulierung gehörten die Prävalenzraten, d. h. die Häufigkeit des Cannabiskonsums in allen vier untersuchten Bundesstaaten sowie in Washington DC zu den höchsten der Vereinigten Staaten. Diese Tatsache wird durch die Zahlen der ersten Monate nach der Regulierung (2013 bis 2014) belegt. Aus den erhobenen Daten geht ebenfalls hervor, dass der Konsum bei Erwachsenen und Minderjährigen in Colorado im Steigen begriffen war.
Diese zu Beginn der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel gestiegenen Konsumzahlen sind aber rückläufig: Daten der nationalen Behörde für Substanzmissbrauch und psychische Gesundheit (SAMHSA) zeigen, dass der Konsum von Cannabis unter Colorados Jugendlichen sowohl im Zeitraum von 2014 bis 2015 als auch im darauffolgenden Jahr immer weiter zurückgegangen ist. Die 30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums bei 12 bis 17 Jahren ist seit 2014 um fast 20 Prozentpunkte gesunken, was der niedrigsten 30-Tage-Prävalenz in Colorado seit 2008 entspricht (vgl.: Nationalen Behörde für Substanzmissbrauch und psychische Gesundheit (SAMHSA), National Survey on Drug Use and Health 2015-2016, aufrufbar: [folgt eine URL].
Auch neuere Erhebungen stützen diese Annahme: “So kommen die Autoren einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Cannabis nach der Legalisierung nicht zugenommen habe. Grundlage für diese Einschätzung waren Daten des Colorado Department of Public Health and Environment. Danach blieb der Konsum von Cannabis in den vergangenen 30 Tagen bei Erwachsenen im Jahr 2015 mit 13,4 Prozent in etwa auf dem Niveau von 13,6 Prozent im Jahr 2014. Auch hinsichtlich des Anteils der Cannabiskonsumenten unter Highschool-Schülern sei demnach kein statistisch signifikanter Anstieg feststellbar gewesen”, so die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags mit Blick auf die Konsumentwicklung in Colorado (siehe: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand: Legalisierung von Cannabis – Auswirkungen auf die Zahl der Konsumenten in ausgewählten Ländern, S.19, veröffentlicht am 21.11.2019).
2016 zeigte Colorado die höchste Prävalenz des Cannabiskonsums in den Vereinigten Staaten: Einer von sieben Erwachsenen mit vollendetem 18. Lebensjahr (15,7 Prozent) und einer von acht Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren (12,56 Prozent) erklärte, im vergangenen Monat mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben (Zobel/Marthaler 2016, S. 15 m. w. N.). Bei den Erwachsenen kann ein zunächst gestiegenes Konsumverhalten auf einen neuen Markt mit einer erweiterten Produktpalette, die Häufigkeit des Cannabiskonsums von Jugendlichen auf eine nicht genügende Umsetzung des Jugendschutzes zurückzuführen sein. Zu den entsprechenden Maßnahmen gehören Testkäufe, Hinweise auf den Verpackungen, Werbeverbote, schärfere Strafen bei Abgabe und Verkauf von Cannabis an Jugendliche, Verbot für Jugendliche, Material zum Konsum von Cannabis bei sich zu tragen. Zudem bilden Aufklärungsmaßnahmen Teil des Jugendschutzes. Eine Kampagne informiert über die Aufbewahrung von Cannabis, über die rechtlichen Folgen der Abgabe oder des Verkaufs an Personen unter 21 Jahren sowie über die Art und Weise, wie Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen kommunizieren sollten (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 15 m. w. N. Zur Entwicklung der Prävalenzen siehe auch: Möller, Prohibitionspolitik, Kapitel D.III.1. Entwicklung der Prävalenzen, S. 155 ff.)
Zwischenzeitlich wird bei Minderjährigen von einem Rückgang im Konsum berichtet (vgl. Knodt, Michael, Colorados Jugendliche kiffen seit der Legalisierung immer weniger, Hanfverband, 15.12.2017, abrufbar unter [folgt eine URL] 15. Dezember 2017). Die Entwicklung des Konsums nach der Legalisierung wird auch in einer Untersuchung von Haucap zusammengefasst (Haucap, Justus/Kehder, Christiane/Feist, Marc/Slowik, Jan, Die Kosten der Cannabisprohibition in Deutschland, 2018, nachfolgend zitiert als Haucap 2018). Danach ergebe sich in Colorado ein gemischtes Bild. So ist der Konsum in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren seit der Legalisierung 2013/2014 zwar von 43,95 Prozent auf 47,54 Prozent im Jahr 2015/2016 gestiegen (Haucap, 2018, S. 28, Abbildung 5: Entwicklung der 12-Monatsprävalenz in Colorado seit der Legalisierung für verschiedene Altersgruppen). Jedoch war für diese Altersgruppe auch schon vor der Legalisierung ein zunehmender Trend im Konsum erkennbar. Ob der gestiegene Konsum tatsächlich durch die Legalisierung induziert wurde, halten die Autoren der Studie für fraglich. Für die Altersgruppe von zwölf bis 17 Jahren ist der Konsum nach der Legalisierung gesunken, und zwar von 20,81 Prozent im Erhebungsjahr 2013/2014 auf 16,21 Prozent in 2015/2016, obwohl vor der Legalisierung auch in dieser Altersgruppe eine Zunahme im Konsum erkennbar ist. Für die Altersgruppen von über 18 Jahren und über 26 Jahren zeigt sich, dass der Konsum im Jahr nach der Legalisierung zugenommen hat und dann jedoch konstant geblieben ist (Haucap 2018, S. 27). Schließlich zeigt die Legalisierung noch eine weitere Wirkung: Die Anzahl der Anzeigen wegen Cannabisdelikten ist stark gesunken. Damit sind entsprechend weniger Personen von Strafverfolgung betroffen. Im ersten Jahr nach der Regulierung sind sowohl in Colorado als auch im Bundesstaat Washington 60 bis 80 Prozent weniger Anzeigen registriert worden. Diese Entwicklung dürfte auch bei den Ordnungskräften zu einer Neuausrichtung ihrer Ressourcen beitragen (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 15).
Prof. Schmid 7 stellt in einem Beitrag vom 29.10.2018 dar (vgl. Schmid, Rainer, Der Vorwurf fehlender Wirksamkeit ist absurd, medical cannabinoids research & analysis, vom 29.10.201/, abrufbar unter [folgt eine URL]), dass die Legalisierung seit 2012 im US-Bundesstaat Colorado zu keiner Steigerung Cannabisverursachter Erkrankungen unter Jugendlichen geführt hat – vielmehr sei die Zahl solcher Erkrankungen bei Jugendlichen gesunken.
Bundesstaaten übergreifend ist die Zahl der Cannabis-Konsumstörungen trotz steigender Beliebtheit von Cannabis einer Studie der University of Columbia zufolge in allen Altergruppen rückläufig (vgl.: Drug ans Alcohol Dependence, Volume 205, Dezember 2019, "Cannabis use disorder among people using cannabis daily/almost daily in the United States, 2002/2016aufrufbar:[folgt eine URL])
bb) Uruguay
In Uruguay dürfen seit 2013 Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, bis zu 40 Gramm Cannabis im Monat besitzen, wobei aber der Konsum im öffentlichen Raum verboten ist. Für den Erwerb der Substanz stehen drei Quellen zur Verfügung: der Selbstanbau von Pflanzen, die Mitgliedschaft in einer Vereinigung von Konsumierenden, welche Cannabis produziert und verteilt sowie der Kauf der Substanz in Apotheken. Ungeachtet der gewählten Versorgung muss jeder einzelne Konsumierende im Register des staatlichen Instituts für die Regulierung und Kontrolle von Cannabis (IRCCA) eingetragen sein. Die ausnahmslose Registrierung aller Marktakteure – auch der Konsumierenden – gibt der Regierung ein Kontrollinstrument über die produzierten Mengen und die Verkaufszahlen an die Hand. Nach diesem System können Personen erfasst werden, die einen problematischen Umgang mit der Substanz zeigen.
Uruguay hat die Höchstmenge für den Erwerb von Cannabis auf 40 Gramm pro Monat oder 10 Gramm pro Woche festgelegt. Diese individuelle Beschränkung wurde auf die drei Bezugsquellen von Cannabis übertragen: Wer die Pflanzen selbst zieht, darf (pro Haushalt) nicht mehr als sechs Exemplare besitzen; Konsumentenvereine müssen 15 bis 45 Mitglieder umfassen und dürfen höchsten 99 Pflanzen besitzen; der Verkauf in der Apotheke ist auf 10 Gramm pro Woche beschränkt (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 18 m. w. N.).
Der Verkauf an Ausländer und die Werbung für Cannabis sind in Uruguay verboten. Das IRCCA soll Qualitätskriterien für die in Apotheken verkaufte Ware festlegen können, wobei ein THC-Gehalt von 5 bis 13 Prozent vorgeschlagen wird. Ebenso will der Staat den Cannabispreis festlegen. Dieser sollte mit ca. 1,20 US-Dollar pro Gramm nahe beim aktuellen Schwarzmarktpreis liegen, wobei sich kleinere Preisunterschiede aus dem unterschiedlichen THC-Gehalt der Produkte ergeben. Von dieser Regulierung erwartet die Regierung Einnahmen zur Finanzierung von Aufklärungskampagnen (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 18). Im August 2014 konnten sich die ersten Interessenten für den Selbstanbau von Cannabispflanzen registrieren lassen. Anfang 2016 zählten die Behörden 3.200 registrierte Personen. Zobel/Marthaler benennen (Stand 2016) 15 Cannabisclubs, weitere drei hatten eine Genehmigung erhalten, und zwölf standen im Genehmigungsverfahren. Mit Stand 11.04.2018 sollen 8.266 Uruguayer beim IRCCA als Heimanbauer registriert sein, dazu kommen insgesamt 83 Cannabisclubs, die ebenfalls beim IRCCA registriert sind (vgl. [folgt eine URL]). Der Verkauf in den Apotheken sollte in der zweiten Hälfte von 2016 beginnen. Diese Abgabestellen sollten höchstens 2 Kilo Cannabis auf dem Lager haben. Weiter sollen sie über Fingerabdruck-Lesegeräte verfügen, damit die Kundschaft mit dem amtlichen Register des IRCCA abgeglichen werden kann. Im Register des IRCCA registrieren können sich nur volljährige uruguayische Staatsangehörige oder permanent Aufenthaltsberechtigte (vgl. [folgt eine URL]). Bisher sind bereits zwei Unternehmen ausgewählt worden, die 6 Tonnen Cannabis für den Verkauf in Apotheken produzieren werden. Die Substanz wird in drei Varianten mit unterschiedlichem THC- und CBD-Gehalt angeboten. Das Modell von Uruguay sieht bis zu fünf dieser Produktionsbetriebe vor. Der Anbau muss auf staatseigenen Grundstücken erfolgen, welche rund um die Uhr bewacht werden. Jede einzelne Pflanze wird erfasst, und ihr Lebenszyklus wird nachverfolgt. Allein der Staat darf die Samen der für die Apotheken bestimmten Produktion importieren oder züchten (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 19).
Eine Hochrechnung des gesamten Cannabiskonsums aus der Höchstmenge von 40 Gramm pro Person und Monat bei 3.200 Selbstanbauern und rund 20 Cannabisclubs lässt einen Konsum von 2 Tonnen pro Jahr ermitteln. Dazu kommen die 6 Tonnen, die für den Verkauf über die Apotheken vorgesehen sind. Die Bedürfnisse des uruguayischen Cannabismarktes, von der Regierung auf 22 Tonnen im Jahr geschätzt, lässt eine Ausweitung des legalen Marktes erwarten (Zobel/Marthaler 2016, S. 19).
Als Begleitmaßnahme zur Cannabislegalisierung hat das nationale Komitee für Drogen (Junta nacional de drogas) im Jahr 2014 eine Aufklärungs- und Informationskampagne lanciert, die sich in erster Linie an die unter 18-jährigen Jugendlichen richtet. Bei dieser Aktion steht sowohl der Alkohol- als auch der Cannabiskonsum im Mittelpunkt (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 19 m. w. N.).
Seit Anfang der 2000er Jahre steigt der Cannabiskonsum in Uruguay. Dieser Trend dürfte weiter anhalten, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen. Das geht aus zwei Studien von 2014 im urbanen Umfeld (Städte mit 10.000 und mehr Einwohnern) hervor. Bei Jugendlichen (13 bis 17 Jahre) beträgt die Prävalenz des Cannabiskonsums im vergangenen Monat durchschnittlich 9,5 Prozent (bei den 17-Jährigen sogar 17,8 Prozent). In der Gesamtbevölkerung (15 bis 65 Jahre) liegt diese Prävalenzrate bei 6,5 Prozent. Eine andere Studie hat das Konsumverhalten von Universitätsstudenten untersucht und dabei eine Prävalenz des Cannabiskonsums im vergangenen Monat von 15,7 Prozent ermittelt. Dieser Wert ist im internationalen Vergleich erheblich, auch wenn in Nord- und Südamerika (Vereinigte Staaten, Chile, gewisse Karibikländer) noch höhere Prävalenzen festgestellt werden (Zobel/Marthaler 2016, S. 19 m. w. N.).
cc) Niederlande
In den Niederlanden wurde der Besitz von 30 Gramm Cannabis und der Anbau von bis zu fünf Pflanzen bereits Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr als Straftat, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit geahndet. 1979 entschied sich die Niederlande zur Anwendung des Opportunitätsprinzips, welche es der Staatsanwaltschaft ermöglichte, ganz auf die Verfolgung zu verzichten. Damit wurden der Besitz aber auch der Verkauf von Cannabis de facto legalisiert, weil nicht mehr zwischen Besitz und der dem Besitz regelmäßig vorweggehenden Erwerbssituation unterschieden und auch nicht darauf abgestellt wurde, dass zwischen Käufer und Verkäufer differenziert werden müsse, soweit es um den Verkauf von Mengen unter 5 Gramm in Coffeeshops ging (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 20 m. w. N.; Möller Prohibitionspolitik Kapitel D. IV. Das Beispiel Niederlande). Amsterdam verfügte als erste Stadt über eine Bewilligungspflicht für Coffeeshops, welche an fünf Bedingungen geknüpft war. Diese Bestimmungen sind bis heute gültig: keine Werbung, keine harten Drogen, keine Störung der öffentlichen Ordnung, kein Verkauf an Minderjährige sowie die Erlaubnis nur kleiner Mengen. Diese Kriterien wurden 1994 auf die ganzen Niederlande ausgedehnt. Später wurden die Bestimmungen weiter verschärft. Die Cannabismenge, die eine Person bei sich tragen und verkaufen durfte, wurde von 30 auf 5 Gramm reduziert. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre kam ein Verkaufsverbot für Alkohol hinzu. Auch wurde ein Mindestabstand von Coffeeshops zu Schulen festgelegt. Der Lagerbestand eines Coffeeshops darf höchstens 500 Gramm betragen. Seit 1996 können die Gemeinden entscheiden, ob ein Coffeeshop eine Zulassung erhält oder nicht; seit 1999 dürfen die örtlichen Behörden sogar Schließungen verfügen (vgl. Zobel/Marthaler a.a.O.; Möller S. 162f.).
Bis zum Ende der 1980er Jahre verkauften die Coffeeshops vor allem importiertes Cannabisharz. Ab 1990 wurde dieses Produkt zunehmend durch illegal angebautes „Gras“ aus den Niederlanden ersetzt. Der Widerspruch im niederländischen Modell – Verkauf ja, Anbau und Import nein – besteht fort (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 19ff. m. w. N.). Waren 1995 noch ca. 1.200 Coffeeshops registriert, ging ihre Zahl 2014/2015 auf 591 bzw. 582 zurück (vgl. Möller S. 163; Zobel/Marthaler S. 20). Sie waren in 103 der insgesamt 505 niederländischen Gemeinden angesiedelt. Amsterdam weist mit geschätzten 200 Geschäften die größte Flächendichte auf. Seit Jahren nimmt die Anzahl der Shops ab. Allerdings könnte diese Entwicklung durch die zunehmende Größe der verbleibenden Geschäfte kompensiert werden. Die Hälfte der Coffeeshops liegt in Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern. Das Projekt der Regierung, Coffeeshops in geschlossene Clubs für registrierte Mitglieder mit niederländischem Wohnsitz umzuwandeln, wurde an die Gemeinden delegiert. Diese Maßnahme soll den „Cannabistourismus“ eindämmen. Es obliegt nun den örtlichen Behörden, die Einrichtung solcher Clubs zu fordern. Das Modell wurde bisher vor allem in grenznahen Städten umgesetzt. Eine neuere Studie konnte belegen, dass der grenzüberschreitende Cannabishandel durch diese Lösung tatsächlich eingedämmt wurde. Allerdings halten derart regulierte Coffeeshops auch Einheimische vom Besuch ab. Es scheint, dass dies zu einer Ausweitung des Schwarzmarktes und damit zu einer vermehrten Störung der öffentlichen Ordnung beiträgt (Zobel / Marthaler 2016, S. 19-22 m. w. N.).
Das in den Niederlanden verkaufte Cannabis stammt aus verschiedenen Quellen. Ein beschränkter Anteil stammt aus Importen. Cannabisharz wird vorwiegend aus Marokko eingeführt; „Gras“ kommt auch aus Albanien und Afrika. Die letztgenannten Importe sollen teilweise zur Streckung des qualitativ hochstehenden einheimischen Cannabis dienen. In den Niederlanden wird im Wesentlichen Indoor-Hanf produziert. Die Bandbreite der Akteure bewegt sich zwischen kleinen lokalen Anbauern bis zu größeren Produktionseinheiten, welche von kriminellen Organisationen betrieben werden. Den zugänglichen Informationen zufolge birgt der Verkauf von selbst produziertem Cannabis scheinbar keine besonderen Hindernisse. Abnehmer sind Coffeeshops, der Schwarzmarkt oder andere Vertreiber (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 21 m. w. N.).
Zobel/Marthaler zitieren eine Studie, die auf ein landesweites Verkaufsvolumen von 139 Tonnen Cannabisblüten und 26 Tonnen Harz hochrechnet. Auch könne darauf geschlossen werden, dass 55 bis 70 Prozent des gesamten niederländischen Cannabishandels über die Coffeeshops abgewickelt wird. Allerdings wisse niemand, welcher Anteil im Land selbst konsumiert wird und welche Menge über die ausländische Käuferschaft abfließe.
Die Coffeeshops bezahlen, wie alle Handelsunternehmen, eine Umsatzsteuer. Sie scheinen hingegen von der Mehrwertsteuer ausgenommen, denn illegale Produkte dürfen nicht mit dieser Abgabe belegt werden. Ein niederländischer Fernsehsender soll offenbar ermittelt haben, dass diese Geschäfte aktuell etwa 300 bis 400 Millionen Euro an Steuereinnahmen für den Staat erwirtschaften würden. Aus den Studienergebnissen lässt sich ein Verkaufspreis für die geläufigsten Cannabisprodukte von rund 10 Euro pro Gramm ermitteln. Je nach Qualität kann der Preis höher oder tiefer liegen (Zobel/Marthaler 2016, S. 21 m. w. N.).
Die nunmehr vierzigjährige Cannabispolitik der Niederlande und ihr einzigartiger Lösungsansatz wurden im Laufe der Zeit vielfach kontrovers diskutiert – oft mit völlig gegensätzlichen Folgerungen. Eine dieser Analysen des niederländischen Modells (MacCoun, Robert, What Can We Learn from the Dutch Cannabis Coffeeshop Experience?, 2010, abrufbar unter [folgt eine URL] im Folgenden zitiert als MacCoun 2010) zieht eine differenziertere Bilanz: In den 1980er und 1990er Jahren hatte der Cannabiskonsum in den Niederlanden zugenommen. Diese Epoche ging mit der Verbreitung der Coffeeshops einher. Damals betrug das Mindestalter noch 16 Jahre, die maximale Verkaufsmenge 30 Gramm und eine gewisse Werbetätigkeit für die Substanz sei nicht zu übersehen gewesen. Aber nach dieser Phase stagnierte der Cannabiskonsum. Die durch Befragungen erhobene Prävalenz war in vielen Fällen mit dem europäischen Durchschnitt vergleichbar – und dies, obwohl die Niederlande das einzige Land war, in dem Cannabis im freien Verkauf angeboten wurde. Ebenso soll der Anteil der intensiv Konsumierenden in den Niederlanden nicht besonders hoch sein. Ferner ist dem niederländischen Modell anzurechnen, dass es ihm tatsächlich gelungen ist, die Drogenmärkte voneinander zu trennen (vgl. MacCoun 2010; Zobel/Marthaler 2016, S. 21 f. m. w. N.; Möller S: 164). Das bestätigen auch die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags. Demnach führt die niederländische Drogenpolitik “zu einem Rückgang der Konsumenten harter Drogen auf ein Niveau, das unterhalb des Niveaus der meisten Länder Westeuropas und den USA” liegt (siehe: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand: Legalisierung von Cannabis – Auswirkungen auf die Zahl der Konsumenten in ausgewählten Ländern, S.9, veröffentlicht am 21.11.2019). Ferner seien einige Studien in den Niederlanden „zu dem Ergebnis gekommen, dass die Entkriminalisierung von Cannabis in den Niederlanden nicht zu einer Explosion des Drogenkonsums geführt und Drogenpolitik nur einen geringen Einfluss auf die Konsumraten habe. Auch gäbe es keinen Beweis für einen Anstieg der Konsumraten durch die Gesetzesänderung im Jahr 1976”, so die Wissenschaftler des Bundestags weiter (siehe: ebd.).
dd) Kanada
In Kanada ist der medizinische Gebrauch von Cannabis seit 2001 gestattet. Den Ausschlag dafür gab ein Gerichtsurteil. Das entsprechende Reglement (Marihuana Medical Access Regulations (MMAR)) erlaubte die Verschreibung der Substanz an Patienten mit bestimmten Diagnosen. Zu Anfang kam nur ein kleiner Personenkreis in den Genuss dieser Regelung, aber in der Folge stieg die Anzahl der berechtigten Personen bis Ende 2013 auf rund 37.000 an. Am 01.04.2014 trat ein neues Reglement in Kraft (Marihuana for Medical Purposes Regulations (MMPR)). Es enthielt zwei wichtige Änderungen: Der Zugang zu Cannabis für den medizinischen Gebrauch erfordert lediglich eine Empfehlung durch eine Fachperson aus dem medizinischen Bereich (Arzt oder Pflegeperson). Zudem muss die Substanz bei einem Produzenten bestellt werden, welcher über eine Sonderlizenz verfügt. Diese Neuerungen beschleunigten die ohnehin rasche Entwicklung des Gebrauchs von Cannabis für medizinische Zwecke. Hier kann von einer „Legalisierung hinter dem Schleier der Medikalisierung“ gesprochen werden (Zobel/Marthaler 2016, S. 28; Fisher, B./Murphy, Y./Rudzinski, K./MacPherson, D., Illicit drug use and harms, and related interventions and policy in Canada: A narrative review of select kex indicators and developments since 2000, International Journal of Drug Policy, 27 (2016), S. 23-35; zu einer entsprechenden Einschätzung gelangt auch das Zentrum für Suchterkrankungen, Cannabis Policy Framework, 2014, m. w. N. auch zu Prävalenzzahlen).
Auch wenn das neue Reglement über den therapeutischen Gebrauch von Cannabis keine spezialisierten Abgabestellen vorsieht, bestanden in Toronto im Jahr 2016 mindestens 40 und in Vancouver sogar 100 solcher Stellen. Die kanadische Provinz Britisch Kolumbien hat eine gemeinsame Grenze mit dem US-Bundesstaat Washington, und dort wurde Cannabis Ende 2012 mit der Einführung eines gewinnorientierten Marktes legalisiert. Nachdem die Behörden von Vancouver diese Tatsache lange ignoriert hatten, nahmen sie im Juni 2015 die Regulierung der Abgabestellen und Compassion Clubs in die Hand.
Die Abgabestellen müssen gewisse Anforderungen an den Standort erfüllen (z. B. Entfernung von einer Schulanlage). Die Produktepalette soll neben rauchbaren Cannabisblüten auch Gelkapseln und Essenzen umfassen. Hingegen sind essbare Erzeugnisse (Kekse oder Bonbons) nicht gestattet, weil sie Kinder zum Konsum verleiten könnten. Die Inhaber der Cannabisabgabestellen dürfen während der vergangenen fünf Jahre keiner Strafverfolgung wegen Betäubungsmitteldelikten ausgesetzt gewesen sein (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 27 f.).
2015 trat der Liberale und später zum Ministerpräsident gewählte Justin Trudeau mit dem Versprechen der Legalisierung des Cannabismarktes an. Die Aufgabe, einen Gesetzesentwurf zu entwickeln, wurde einem Abgeordneten und ehemaligen Polizeichef von Toronto übertragen. Er leitet eine Expertengruppe mit national und regional tätigen Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und der Suchtforschung. Verschiedene Regulierungsmodelle standen zur Debatte, darunter auch ein staatliches Monopol, wie es in einigen Provinzen für den Alkohol gilt. Zwischenzeitlich – im Juni 2018 – hat Kanada den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Der Besitz, Erwerb und Konsum von Cannabis ist in Kanada je nach Provinz für Personen ab 18 bzw. 19 Jahren eine legale Handlung, sofern die außerhalb der eigenen Wohnung mitgeführte Menge 30 Gramm nicht übersteigt. Der Handel erfolgt über staatlich lizenzierte Abgabestellen. Das Gesetz trat am 17.10.2018 in Kraft. Als gesetzgeberische Ziele der regulierenden Freigabe wurden genannt: Produktsicherheit und Qualitätskontrolle zum Schutze der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit; Schutz der Jugend vor dem Zugang zu Cannabis; Verbot von Werbung; Überwachung der legalen Produktion; Verringerung der Belastung für Polizei und Justiz; nachhaltige Öffentlichkeitskampagnen und Informationen über die Gefahren des Cannabiskonsums (vgl. Wilkins, Kathryn/Mazowita, Benjamin/Rotermann, Michelle, Preparing the social statistics system for the legalization of cannabis, 2018, abrufbar unter [folgt eine URL]; die Fundstelle zitiert ausführlich, welche Evaluationsprogramme durchgeführt werden sollen). Der Spiegel zitiert eine Twitter-Kurznachricht des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau: „Es war zu einfach für unsere Kinder, Marihuana zu bekommen – und für Kriminelle, die Profite davon einzusacken. Heute ändern wir das“ (vgl. Spiegel Online, Kanada legalisiert Cannabis vom 20.06.2018, abrufbar unter [folgt eine URL]). Zahlen über Prävalenzen und Entwicklungen des Konsums liegen nicht vor. Nach einem Bericht der Tagesschau (ARD) vom 18.10.2018 gab es einen landesweiten Ansturm auf die Verkaufsstellen und Marihuana war schon am ersten Tag ausverkauft (vgl. Clement, Kai, Kaum legal schon ausverkauft, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Die Tagesschau berichtet (a. a. O.) weiter, dass die Preise pro Gramm Cannabis je nach Ausgabeort und Ware zwischen 3,50 Euro in Quebec bis hin zu knapp 12 Euro in den abgelegenen Nordwest-Territorien schwanken. Weiter wird berichtet, dass die Regierung nun ein weiteres Gesetz plane, mit dem den bislang schon wegen Marihuanabesitzes Verurteilten eine schnellere Tilgung des Strafeintrages ermöglicht wird. Einer Studie zufolge könnte das für mehr als eine halbe Million Kanadier gelten (Clement: Tagesschau vom 18.10.2018, a.a.O.).
ee) Belgien, Frankreich und Italien
In Belgien, Frankreich, Italien und Spanien gibt es mehrere Gründungen sogenannter Cannabis Social Clubs (CSC). Die Rechtslage bleibt in diesen Ländern aber unklar. Die Informationslage über diese CSC ist wegen ihrer Illegalität zumeist unklar. Zobel/Marthaler berichten über den rechtspolitisch sehr aktiven Verein Trekt Uw Plant („Ziehe deine Pflanze“) in den Jahren 2006 in Belgien und über Medienberichte zu entsprechenden Vereinen in Frankreich und der Gründung eines derartigen Vereins in Rom, Italien (Zobel/Marthaler 2016, S. 28 f. m. w. N.) sowie eine überparteiliche Initiative im italienischen Parlament im Jahr 2015.
Hinsichtlich der Entwicklung des Cannabiskonsums in Belgien halten die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages folgendes fest: “Bezogen auf das Erhebungsjahr 2013 lag die Konsumprävalenz junger Erwachsener im Alter von 15 bis 34 Jahre in Belgien bei 10,1 Prozent und damit deutlich unter dem Wert für die Europäische Union (EU), der mit 26,3 Prozent angegeben wurde. Bereits im Jahr 2008 lag die Lebenszeitprävalenz für Erwachsene im Alter von 15 bis 64 Jahre in Belgien bei lediglich 14,3 Prozent im Vergleich zum EUDurchschnitt in Höhe von 23,3 Prozent. Im Hinblick auf die Lebenszeitprävalenz bei belgischen Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren ist seit der Liberalisierung der belgischen Drogengesetzgebung ebenfalls ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. So ist der Wert zwischen den Jahren 2003 und 2011 von 31 Prozent auf 24 Prozent gesunken; im Jahr 2013 lag dieser bei 18 Prozent und damit erneut auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Diese Entwicklung wird als Zeichen dafür gewertet, dass die Entkriminalisierung von Cannabis keinen negativen Einfluss auf das Konsumverhalten von Jugendlichen hatte” (siehe: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand: Legalisierung von Cannabis – Auswirkungen auf die Zahl der Konsumenten in ausgewählten Ländern, S.7, veröffentlicht am 21.11.2019).
ff) Luxemburg
In Luxemburg ist beabsichtigt Cannabis für den privaten Gebrauch aus Gründen der Suchtprävention weitgehend zu legalisieren (vgl. Zeit Online, Luxemburg legalisiert Cannabis für privaten Gebrauch, Zeit Online vom 04.12.2018, abrufbar unter [folgt eine URL]). Der luxemburgische Justizminister Felix Braz wird in der Presse wie folgt zitiert:
| „Wir müssen einsehen, dass wir mit einem rein repressiven Ansatz dem Problem nicht beikommen.“ (Luxemburger Wort vom 19.09.2014). |
gg) Schweiz
In der Schweiz ist gegenwärtig der Konsum von Cannabis mit einem Tetrahydrocannabinol(THC)-Gehalt von mehr als 1 Prozent grundsätzlich verboten. Der Besitz von bis zu 10 Gramm Cannabis für den eigenen Konsum ist nicht strafbar. Seit 2013 kann der Konsum von Cannabis durch erwachsene Personen mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken bestraft werden. Für Minderjährige gilt das Jugendstrafrecht (vgl. Faktenblatt des Bundesamtes für Gesundheit BAG, Schweizerische Eidgenossenschaft vom 04.07.2018). Cannabis mit einem Gesamt-THC-Gehalt von unter 1,0 Prozent gilt gemäß Verzeichnis der BetmVV-EDI nicht als Betäubungsmittel, weshalb Ausnahmebewilligungen gemäß Art. 8 Abs. 5 BetmG keine Anwendung finden. Der Umgang mit Cannabis mit einem Gesamt-THCGehalt von mehr als 1,0 Prozent THC untersteht demnach nicht der Bewilligungspflicht des BAG. Davon ausgenommen ist der Cannabisharz (Haschisch), welcher gemäß BetmVV-EDI unabhängig vom THC-Gehalt eine verbotene Substanz darstellt und deshalb für den Umgang einer Ausnahmebewilligung des BAG bedarf.
Für Cannabis und Cannabiszubereitungen mit einem Gesamt-THC-Gehalt unter 1,0 Prozent ist bei der Einfuhr nachzuweisen, dass die zur Einfuhr vorgesehenen Produkte einen GesamtTHC-Gehalt unter 1,0 Prozent aufweisen. (vgl. Produkte mit Cannabidol, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 30.11.2018).
Zum Rauchen bestimmte Cannabisblüten, die einen hohen Anteil an Cannabidiol (CBD) und weniger als 1 Prozent THC aufweisen, können legal verkauft und erworben werden. CBD steht für Cannabidiol und ist neben THC das wichtigste in Cannabis enthaltene Cannabinoid. Während THC für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich ist, hat CBD keine psychotrope Wirkung und wird entsprechend nicht durch das schweizerische Betäubungsmittelgesetz erfasst.
In der Schweiz möchten verschiedene Städte im Rahmen von Forschungsprojekten den geregelten Verkauf von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken ausprobieren. Sie verweisen auf die negativen Auswirkungen der aktuellen gesetzlichen Regelung. Vor allem der illegale Handel im öffentlichen Raum wird von der Bevölkerung zunehmend als störend und verunsichernd empfunden. Zudem bindet die Repression in den städtischen Gebieten viele Ressourcen. Einzelne Städte wollen deshalb herausfinden, wie sich ein kontrollierter Zugang zu Cannabis auf den Konsum, das Kaufverhalten und auf die Gesundheit der teilnehmenden Personen auswirkt.
Das Bundesamt für Gesundheit konnte 2017 ein Gesuch der Universität Bern für die Durchführung eines wissenschaftlich begleiteten Pilotversuchs in der Stadt Bern nicht bewilligen. Das geltende Betäubungsmittelgesetz verbietet den Konsum von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken auch im Rahmen wissenschaftlicher Studien. Der Bundesrat vertritt jedoch die Ansicht, dass solche Studien dazu beitragen könnten, die Diskussion zu versachlichen und wissenschaftliche Grundlagen für allfällige spätere Gesetzesänderungen zu beschaffen. Bei den vorgesehenen Pilotversuchen geht es nicht um die Frage, ob Cannabis legal werden soll oder nicht, sondern darum, welche Regelung die öffentliche Gesundheit am wenigsten belastet. Der Bundesrat schlägt deshalb eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vor, damit wissenschaftliche Pilotversuche mit Cannabis in engen Grenzen durchgeführt werden können. Er hat am 4. Juli ein entsprechendes Rechtsetzungsprojekt in die Vernehmlassung gegeben (vgl. Faktenblatt des Bundesamtes für Gesundheit BAG, Schweizerische Eidgenossenschaft, 04.07.2018).
hh) Spanien
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts urteilte der Oberste Gerichtshof, dass der alleinige Besitz und Konsum von Drogen keine Straftat darstellt, sofern kein Handel damit betrieben wird. Diese Rechtsprechung gilt analog für die Aufzucht von Cannabispflanzen für den persönlichen Gebrauch. Die Konsumierenden müssen allerdings nachweisen, dass die Ernte nicht für den Handel bestimmt ist. Ebenso befand das oberste Gericht später, dass der gemeinschaftliche Konsum und Einkauf von Drogen durch abhängige Personen keine Straftat begründet.
Der 1993 gegründete Verein Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC) baute für seine rund hundert Mitglieder selbst Cannabis an und führte dazu folgendes Argument ins Feld: Der Anbau einer oder mehrerer Pflanzen für den Eigenbedarf stellt keine Straftat dar. Dasselbe gilt für den gemeinschaftlichen Einkauf von Cannabis sowie für den gemeinsamen Konsum. Also könne es auch keine Straftat sein, wenn ein privater Personenkreis Pflanzen anbaut, die Ernte unter sich aufteilt und das Cannabis gemeinsam konsumiert (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 23 m. w. N.). Zwar wurden Mitglieder der ARSEC in der Folge durch alle Instanzen verurteilt. Ihr Vorbild hatte aber zur Folge, dass vor allem im Baskenland und in Katalonien zahlreiche so genannte Cannabis Social Clubs (CSC) gegründet wurden, denen Behörden widersprüchlich begegneten. Ein von der Regierung Andalusiens in Auftrag gegebene und 2001 publizierte Studie legte die Bedingungen dar, unter welchen Cannabis produziert und verteilt werden darf, ohne gegen das Gesetz oder die Rechtsprechung zu verstoßen: Die Clubs dürfen nur Erwachsene aufnehmen, die bereits Cannabis konsumieren. Ferner darf aus der Produktion und Verteilung des Cannabis‘ kein Gewinn erwachsen. Schließlich muss sichergestellt sein, dass die Produkte ausschließlich von Clubmitgliedern konsumiert werden (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 24 m. w. N.).
Die Clubs müssen in einem nationalen Register eingetragen sein und ihren Vereinszweck offenlegen, nämlich die Produktion und Verteilung von Cannabis an die Mitglieder und die Reduktion der Risiken, die mit dem Konsum einhergehen. Der Abgabepreis von Cannabis für die Mitglieder umfasst lediglich die Produktions- und Verwaltungskosten. Er soll unter dem Schwarzmarktpreis liegen. Zudem sind die CSC steuerpflichtig und müssten womöglich auch Mehrwertsteuer entrichten (Zobel/Marthaler 2016, S. 24 m. w. N.), aber über das Volumen dieser Abgaben ist nichts bekannt. Wer einem CSC beitreten möchte, muss sich selbst als Cannabiskonsumierender erklären oder eine Verschreibung dieser Substanz für den medizinischen Gebrauch vorweisen. In einigen CSC ist zusätzlich die Empfehlung eines Clubmitglieds notwendig. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre (Volljährigkeit), in einigen Clubs sogar 21 Jahre. Der gesetzliche Wohnsitz kann ein weiteres Kriterium für die Clubmitgliedschaft darstellen. Die Menge Cannabis, die der Einzelne beziehen darf, ist im Voraus festgelegt und liegt üblicherweise bei höchstens zwei bis drei Gramm pro Tag. Oft findet der Konsum vor Ort statt, um sicherzustellen, dass die Substanz nicht weiterverkauft wird. Bei der Aufnahme in den CSC sollen Kandidaten mit problematischem Konsumverhalten erfasst werden, damit die Clubverantwortlichen, wenn nötig, präventive oder schadenmindernde Maßnahmen ergreifen können. Über die konsumierte Cannabismenge wird für jedes Mitglied Buch geführt. Die Gesamtproduktion eines CSC muss auf der Hochrechnung der Mitgliederbedürfnisse fußen. Eine zusätzliche Reserve ist gestattet. Der Anbau der Cannabispflanzen kann entweder durch Personen aus dem Verein erfolgen oder Landwirten anvertraut werden. In jedem Fall müssen alle Phasen der Produktion protokolliert werden. Idealerweise sollten Inspektionen durch die Behörden stattfinden (Zobel/Marthaler 2016, S. 25 m. w. N.). Im Zuge der raschen Verbreitung der CSC haben einige regionale Verwaltungen Kriterien für den Betrieb der Vereine entwickelt. Allerdings dürfen sich diese Anforderungen weder zum Anbau noch zum Transport oder der entgeltlicher Weitergabe von Cannabis äußern, denn diese Aspekte werden in der nationalen Gesetzgebung über die Betäubungsmittel geregelt. Das Landesparlament Kataloniens verabschiedete 2017 ein Gesetz, das die Standards für die Gründung von Cannabis Social Clubs, das vom spanischen Verfassungsgericht 2018 als “nicht verfassungswidrig“ eingestuft wurde. Allerdings regelt es die oben angeführten, heiklen Punkte Anbau, Transport und Weitergabe nicht rechtsverbindlich.
Auch heute gelten die CSC als nicht gewinnorientierte private Vereine. Das katalanische Regulativ umfasst folgende Anforderungen: Ausbildung der Verantwortlichen der Cannabisclubs; Früherfassung von Mitgliedern mit problematischem Konsumverhalten; Verbot von Alkohol und anderen Drogen; Anwendung der Vorschriften des Tabakgesetzes; Einhaltung eines Mindestabstands zu Schulen und Gesundheitseinrichtungen; Befolgung der Betriebsdauer (maximal 8 Stunden täglich) sowie der Schließzeiten (22 Uhr an Werktagen, 24 Uhr am Wochenende); Verbot von Werbung; Beachtung der Bestimmungen über Hygiene und Umweltschutz. Zudem gilt für neue Clubmitglieder in einigen Clubs eine Karenzfrist von 15 Tagen zwischen dem Beitrittsgesuch und der erstmaligen Abgabe von Cannabis (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 25 m. w. N.). Es gibt in Spanien keine offiziellen Angaben zur Anzahl der CSC. Zobel/Marthaler berufen sich auf eine Schätzung, die von 500 bis 600 Clubs spricht. Die meisten von ihnen befinden sich in Katalonien (ca. 350) und im Baskenland (ca. 75). In Katalonien soll es 20 Clubs mit mehr als 1.000 Mitgliedern geben, zwei davon mit über 10.000. Einige CSC haben sich zu Vereinigungen zusammengeschlossen. Eine davon (CatFAc) beschränkt die Mitgliederzahl auf 650. Ferner dürfen pro Person im Monat höchstens 60 Gramm Cannabis abgegeben werden. Eine andere Vereinigung (FedCat) kennt keine Mengenbeschränkung, und die Höchstmenge pro Mitglied beträgt 100 Gramm im Monat. Eine Vorstellung über das Gesamtvolumen, welches in den CSC konsumiert wird, kann mit folgender Hypothese hergestellt werden: Man nimmt an, dass die rund 500 existierenden CSC im Durchschnitt 500 Mitglieder umfassen. Das ergibt insgesamt 250.000 Personen. Wenn jede dieser Personen 30 Gramm im Monat (360 Gramm im Jahr) konsumiert, würde sich ein Gesamtvolumen von 90 Tonnen Cannabis im Jahr ergeben (Zobel/Marthaler 2016, S. 25 m. w. N.). Aufgrund der verfügbaren Zahlen hat der Cannabiskonsum in Spanien um die Jahrtausendwende zugenommen. Danach trat eine Stabilisierung ein, und seit 2009 stellt man sogar einen Rückgang des Konsums fest. Die letzten Daten stammen allerdings von 2013 und decken nicht die gesamte Periode der Verbreitung der CSC ab. Die nächste Erhebung bleibt abzuwarten. Die künftigen Zahlen aus Katalonien und dem Baskenland müssen vorliegen, bevor verlässlichere Aussagen über die Konsumentwicklung möglich sind. Immerhin wies Spanien im Dezember 2013 die höchste Prävalenz des Cannabiskonsums im letzten Monat in Europa auf: 6,6 Prozent in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren. Nur in Frankreich wurden 2014 vergleichbare Konsumzahlen erhoben (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 26 m. w. N.).
Mittlerweile haben sich das Oberste Gericht des Landes (Tribunale Supremo, vglb. dem BGH) sowie das spanische Verfassungsgericht mehrfach mit Fällen von Cannabis Social Clubs beschäftigt. Denn auch wenn einige Landes- oder Lokalparlamente (Bsp: Barcelona in Katalonien, Narvarra im Baskenland) Regularien verabschiedet hatten, betrachten viele Staatsanwälte und Richter das Agieren der Clubs weiterhin als einen Verstoß gegen das auf Bundesebene geltende Betäubungsmittelgesetz. So klagen besonders die baskischen Clubs seit einem Urteil des Verfassungsgerichts Ende 2017 über zunehmende Repressalien seitens nationaler Strafverfolgungsbehörden.
Im Dezember 2017 erklärten die Verfassungsrichter das Gesetz der autonomen Region Narvarra im Baskenland zur Regulierung von Cannabis Social Clubs für ungültig, da es gegen nationales Recht sowie das UN-Einheitsabkommen über Betäubungsmittel verstoße (Urteil 144/2017 vom 14.12.2017). Im März 2018 erklärten die Verfassungsrichter das Gesetz, das das katalanische Parlament 2017 zur Regulierung der Cannabis Social Clubs verabschiedet hatte (s.u.), für „nicht verfassungswidrig“ (Urteil 29/2018). Allerdings nur, weil es lediglich dem Konsum, nicht aber dem Anbau und der Abgabe von Cannabis einen rechtlichen Rahmen setze und nur ganz allgemein „eine Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden“ fordert. Die spanischen Verfassungsrichter haben im Urteil angemerkt, dass sich das Gericht nicht in die gesellschaftliche Diskussion um die rechtliche Stellung von Cannabis einmischen könne und somit das nationale BtMG ausschlaggebend zur Urteilsfindung sein müsse. Im Februar 2018 hob das Oberste Gericht nach einer Stellungnahme des Verfassungsgerichts ein eigenes Urteil aus dem Jahr 2015 auf und sprach fünf Mitglieder eines Cannabis Social Clubs (EBERS/Bilbao) aufgrund von Verfahrensfehlern frei. Diese waren 2015 zu Haftstrafen und Bewährungsstrafen verurteilt worden (Urteil 91/2018). Im Oktober 2018 verurteilte das Oberste Gericht den Präsidenten und den Schatzmeister eines baskischen Clubs zu je drei Monaten Haft ohne Bewährung sowie einer geringen Geldstrafe. In der Begründung heißt es, die Betreiber hätten zugelassen, dass ihre Mitglieder Cannabis auch mitnehmen und somit öffentlich konsumieren konnten.
ii)Portugal
Bereits vor 19 Jahren fand eine umfassende Entkriminalisierung und eine damit verbundene Liberalisierung der Drogenpolitik in Portugal statt. Mit dem am 01.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz 30/2000 gilt der Besitz, Erwerb und Konsum sämtlicher illegaler Drogen, nicht nur Cannabis, in geringer Menge nicht mehr als Straftat, sondern wird als Ordnungswidrigkeit eingestuft (vgl. „15 Jahre entkriminalisierte Drogenpolitik in Portugal, Ralf Streck, 2016. Abrufbar unter: [folgt eine URL]). Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis beziehungsweise bis zu fünf Gramm Cannabisharz entspricht hierbei der vom Gesetzgeber festgehaltenen Zehn-Tagesdosis und wird seit 2001 nicht mehr strafrechtlich geahndet. Konsumenten, die mit einer Menge an Drogen unterhalb dieser Dosis angetroffen werden, werden von der Polizei an die CDT, die Commissöes para a Dissuasäo da Toxicodependencia, übermittelt (vgl. „Legalisierung von Cannabis – Auswirkungen auf die Zahl der Konsumenten in ausgewählten Ländern“, Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, S. 13, Aktenzeichen WD 9-3000 -072/19, 21. November 2019).
In der Kommission zur Vermeidung des Drogenmissbrauchs befragen Juristen, medizinische Fachkräfte und Sozialarbeiter Drogenkonsumenten mit dem Ziel, eine soziale Stigmatisierung sowie traumatische Folgen einer Gerichtsverhandlung zu vermeiden, aber auch um mögliche Therapieformen zu empfehlen (vgl. Drogenpolitik in Portugal: Die Vorteile einer Entkriminalisierung des Drogenkonsums, S.20, Open Society Foundations, 2011, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Darüber hinaus hat die CDT auch Sanktionsmöglichkeiten: Mehrfach auffällige Konsumenten müssen mit einer Geldbuße rechnen, sie kann unter anderem gemeinnützige Arbeit oder den Entzug der Fahrerlaubnis anordnen und eine mehrwöchige Gruppentherapie durchsetzen (vgl. ebd.). Zwischen 2002- 2013 war der mit über 80% weit überwiegende Teil aller in der Kommission zur Vermeidung des Drogenmissbrauchs vorstellig gewordenen Konsumenten wegen des Besitzes von Cannabis dort (vgl. „Legalisierung von Cannabis –Auswirkungen auf die Zahl der Konsumenten in ausgewählten Ländern“, Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, S. 14, Aktenzeichen WD 9-3000 -072/19, 21. November 2019). Ursprünglich eingeführt, um den Problemen mit härteren Drogen wie Heroin in den Griff zu bekommen, hat sich das Gesetz 30/2000 auch beim Umgang mit Cannabiskonsumenten bewährt, es kam im Zuge der Entkriminalisierung von geringen Mengen zum Eigenbedarf nicht zu einem starken Anstieg der Konsumentenzahlen. Zu diesem Fazit kommt auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, der zur Entwicklung in Portugal wie folgt resümiert: „Gegner der Entkriminalisierung befürchteten durch das Inkrafttreten des Gesetztes 30/2000 einen starken Anstieg der Konsumentenzahlen in Portugal. Ein entsprechender Anstieg lässt sich jedoch aus den vorliegenden Daten nicht ablesen; vielmehr habe die Entkriminalisierung nur geringen Einfluss auf die Anzahl der Konsumenten gehabt. Zwar sei die Lebenszeitprävalenz in Portugal leicht gestiegen, allerdings entspreche dies der grundsätzlichen Entwicklung in Europa. Auch läge die Lebenszeitprävalenz für den Konsum von Cannabis in Portugal bei elf Prozent und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 26,3 Prozent. Auch sei die Lebenszeitprävalenz in der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen in den Jahren 2007 bis 2012 von zwölf auf neun Prozent gefallen. Der Konsum von Cannabis in der letzten Zeit (recent use) sei in diesem Zeitraum ebenfalls von 3,7 auf 2,7 Prozent, der andauernde Konsum von 31 auf 28 Prozent gesunken. Studien zufolge habe es einen stetigen Rückgang der Anzahl der problematischen Drogenkonsumenten in Portugal gegeben, auch habe die Anzahl der Konsumenten, die Drogen injizieren, seit der Entkriminalisierung um mehr als 40 Prozent abgenommen“ (siehe: Legalisierung von Cannabis-Auswirkungen auf die Zahl der Konsumente in ausgewählten Ländern“, Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, S. 14, Aktenzeichen WD 9-3000 -072/19, 21. November 2019).
d) Stellungnahmen der Global Commission on Drug Policy, Weltkommission für Drogenpolitik
Seit 2011 mahnt die Weltkommission für Drogenpolitik eine rationalere und liberalere Drogenpolitik an. Insbesondere werden Regulierungsmodelle für den Umgang mit Cannabis gefordert – einerseits um dem illegalen Drogenmarkt das Geld zu entziehen, andererseits um die Gesundheit der Drogenkonsumierenden besser zu schützen. Mitglieder der Kommission sind ehemalige Regierungschefs und Personen des öffentlichen Lebens wie Aleksander Kwasniewski, ehemaliger Präsident von Polen, Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und viele weitere mehr. Ghana, Nick Clegg, ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident des Vereinigten Königreichs von Groß Britannien, UK, Asma Jahangir, Menschenrechtsaktivistin, ehemalige UN-Sonderberichterstatterin über willkürliche, außergerichtliche und summarische Hinrichtungen, Pakistan, Carlos Fuentes, Schriftsteller und Intellektueller, Mexiko – in memoriam, César Gaviria, ehemaliger Präsident von Kolumbien, Ernesto Zedillo, ehemaliger Präsident von Mexiko, Fernando Henrique Cardoso, ehemaliger Präsident von Brasilien (Vorsitz), George Papandreou, ehemaliger Ministerpräsident von Griechenland, George P. Shultz, ehemaliger Außenminister, Vereinigte Staaten (Ehrenvorsitz), Javier Solana, ehemaliger Generalsekretär für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Spanien, John Whitehead, Bankier und Beamter, Vorsitzender der World Trade Center Memorial Foundation, Vereinigte Staaten, Louise Arbour, ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Präsidentin der International Crisis Group, Kanada, Maria Cattaui, ehemalige Generalsekretärin der Internationalen Handelskammer, Schweiz, Mario Vargas Llosa, Schriftsteller und Intellektueller, Peru, Marion Caspers-Merk, ehemalige Staatssekretärin, Bundesministerium für Gesundheit, Deutschland, Michel Kazatchkine, ehemaliger Geschäftsführer des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, Frankreich, Paul Volcker, ehemaliger Vorsitzender der Notenbank der Vereinigten Staaten und des Economic Recovery Board, Pavel Bém, ehemaliger Oberbürgermeister von Prag, Mitglied des tschechischen Parlaments, Ricardo Lagos, ehemaliger Präsident von Chile, Richard Branson, Unternehmer, Aktivist für soziale Gerechtigkeit, Gründer der Virgin Group, Mitbegründer von The Elders, Vereinigtes Königreich, Ruth Dreifuss, ehemalige Bundespräsidentin und Vorsteherin der Eidgenössischen Departements des Innern, Schweiz, Thorvad Stoltenberg, ehemaliger Außenminister und UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Norwegen.
aa) Die Berichte 2011 und 2012
Im Juni 2011 berichtete die Weltkommission für Drogenpolitik (nachfolgend zitiert: Weltkommission), dass sie den weltweiten Krieg gegen die Drogen für gescheitert erachtet und dass die nationale wie auch die weltweite Drogenpolitik einer dringenden grundlegenden Reform bedarf. Ausgeführt wurde, dass es trotz hoher Aufwendungen für die Kriminalisierung und für repressive Maßnahmen gegen Produzenten, Dealer und Konsumenten von illegalen Drogen nicht gelungen ist, das Angebot und den Konsum wirksam einzuschränken. Scheinbare Erfolge bei der Ausschaltung einer Quelle oder Dealerorganisation werden fast auf der Stelle durch das Aufkommen neuer Quellen und Dealer zunichtegemacht. Die auf die Drogenkonsumierenden ausgerichtete Repression behindert Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, die darauf abzielen, HIV/Aids, tödliche Überdosen und weitere schädliche Folgen des Drogenkonsums einzudämmen. Die staatlichen Aufwendungen für aussichtslose Strategien zur Verringerung des Angebots und für die Inhaftierung verdrängen kostenwirksamere und evidenzbasierte Investitionen in die Verringerung der Nachfrage und die Schadenminderung.
Im Juni 2012 berichtete die Weltkommission für Drogenpolitik über die Gefahren der Kriminalisierung des Drogenkonsums. Der Titel des Berichts lautet:
| „Wie die Kriminalisierung des Drogenkonsums die globale Pandemie anheizt“. |
Die Kommission beanstandete wiederholt, dass der gegenwärtige Drogenkrieg „gescheitert“ sei, und dass es für die Regierungen nun an der Zeit sei, ihre Vorgehensweise bei dem Umgang mit Drogenkonsum zu ändern.
Anstatt Drogen zu verbieten und kriminalisieren, fordert die Kommission die Regierungen und Führungskräfte auf, sich für eine moderne Politik zu entscheiden, welche die Menschenrechte, die Gesundheit und die Sicherheit priorisiert und gleichzeitig die durch Drogen verursachten Schäden an Einzelpersonen und Gesellschaften mindert (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 2).
bb) Der Bericht 2016
Im Bericht von 2016 begrüßt die Weltkommission, dass es einen beginnenden Wandel in der Drogenpolitik gibt und dies vor allem in der steigenden Zahl der Länder deutlich werde, die den Cannabismarkt regulieren und damit verschiedene Alternativen zur Kriminalisierung für Drogenkonsumierende einführen. Sie fordert einen grundlegenden Wandel in der Drogenpolitik.
Die Weltkommission führt aber gleichwohl kritisch aus, dass es an der Zeit sei, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, wie Drogen und Drogenkonsumierende in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Sie weist darauf hin, dass psychoaktive Substanzen die Menschheit in ihrer Geschichte schon immer begleitet haben. Einige sind vielerorts rechtlich akzeptiert, wie Alkohol und Tabak; andere gelten als Arzneimittel und werden medizinisch verschrieben und wieder andere, im Zusammenhang mit unerlaubtem Konsum als „Drogen“ bezeichnete, sind unter den internationalen Abkommen verboten. Der Bericht legt dar, dass die große Mehrheit der Menschen diese Substanzen auf verantwortungsvolle Weise konsumiert, es aber auch jene gibt, die Gefahr laufen, ihrer Gesundheit zu schaden und soziale und berufliche Schwierigkeiten zu bekommen. Die Illegalität der Drogen setzt die Konsumierenden aber viel größeren Risiken aus: Sie müssen sich auf einen kriminellen Markt einlassen, der sie abhängig macht und den größtmöglichen Profit einfahren will, und riskieren repressive Maßnahmen. Diese Kombination von rechtswidrigem Angebot und Kriminalisierung ist besonders grausam und entwürdigend für Menschen, die abhängig geworden sind, und für jene, die sich Drogen als Selbstmedikation für körperliche oder seelische Leiden zuführen. Die Prohibition macht Gesellschaften und Regierungen blind für die zahlreichen Gründe, warum Drogen entweder kontrolliert oder problematisch konsumiert werden. Dies, so der Bericht der Kommission, trägt dazu bei, dass Drogenkonsumierende verstärkt diskriminiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Sie werden als unwürdig betrachtet, Verständnis und Hilfe zu erhalten, bräuchten aber eigentlich Behandlung und soziale Integration. Außerdem rechtfertigt die Prohibition die Kriminalisierung von Menschen, die keine Gefahr für andere darstellen, und bestraft jene, die leiden. Sie schränkt zudem die wissenschaftliche Erforschung möglicher medizinischer Verwendungszwecke illegaler Substanzen ein und erschwert die Verschreibung von Schmerzmitteln und palliativen Medikamenten.
Die Weltkommission wendet sich auch der Normenakzeptanz und deren Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander zu und führt aus, dass bei einer so großflächigen Missachtung von unsinnigen Drogengesetzen ein strafrechtlicher Ansatz in der Drogenkontrolle die Beziehung zwischen dem Bürger und dem Staat tiefgreifend untergräbt. Die Kommission bemängelt, dass die meisten Regierungen leider nach wie vor am Ziel einer „drogenfreien Welt“ oder einer „Welt ohne Drogenmissbrauch“ festhalten, wie sie in den internationalen Drogenabkommen festgeschrieben sind. Diese Zielsetzungen werden als naiv und gefährlich beschrieben. Naiv sind sie, weil die Prohibition bisher nur geringen oder gar keinen Einfluss auf den Drogenkonsum hatte, mit einem Anstieg der Konsumierenden von 2006 bis 2013 von fast 20 Prozent auf 246 Millionen Menschen; gefährlich, weil die Prohibition völkerrechtswidrigen Masseninhaftierungen und Hinrichtungen (in einer Vielzahl von Ländern) Vorschub leistet, die Verbreitung von durch Blut übertragenen Viren begünstigt (vor allem in osteuropäischen, aber auch asiatischen Staaten), Drogenkonsumierende und Dealer Menschenrechtsverletzungen aussetzt und zu den weltweit jährlich 200.000 Drogentoten beiträgt. Landesregierungen müssen sich dringend aus den Zwängen dieses veralteten und auf Strafe ausgerichteten Rahmens befreien (zur weitgehenden Wirkungslosigkeit der Prohibition vgl. auch: Möller, S. 141 ff., S. 149 ff., S. 9 ff.).
Die Weltkommission fordert, dass zugleich klar definiert werden muss, was mit Kriminalisierung gemeint ist. Konstatiert wird, dass viele Lokalbehörden und Landesregierungen Alternativen zu Bestrafungen eingeführt haben, strafrechtliche Maßnahmen gegen Drogenkonsumierende abgeschafft und mit administrativen Sanktionen wie Bußen (Bußgeldern) ersetzt, oftmals kombiniert mit medizinischen Behandlungen und sozialen Maßnahmen. Gleichwohl geht die Kommission davon aus, dass diese Alternativen nicht weit genug gehen. In diesem Bericht fordert die Weltkommission die Aufhebung sämtlicher bestrafenden Reaktionen auf Drogenbesitz und -konsum. Gefordert wird weitergehend, dass die gewaltlose Beteiligung an Drogenproduktion und Drogenhandel ebenfalls überdacht werden muss, wenn sie aus einer prekären wirtschaftlichen Lage und sozialen Randständigkeit heraus geschieht. Vorgeschlagen werden Alternativen zur Bestrafung und die Unterstützung von verwahrlosten Gemeinschaften als Wege, Einzelne und ganze Gemeinschaften aus der Gewalt des organisierten Verbrechens zu befreien, neue wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen und die Rechte und Würde aller zu respektieren (die vorweggehenden Ausführungen entstammen dem Vorwort des Berichts von Ruth Dreyfuss, der ehemaligen Bundespräsidentin und ehemaligen Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren, Schweiz, Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik, 2016).
Es soll schließlich noch darauf hingewiesen werden, dass es im Dezember 2020 oder März 2021( ursprünglich im März 2020 ) es aller Voraussicht nach zu einer Neuklassifizierung von - Cannabis durch die Weltgesundheitsorganisation WHO kommen wird, die empfehlen wird, Cannabisblüten und Cannabisharz aus der Liste der gefährlichsten Drogen, der Anlage IV der Single Convention, zu streichen (vgl.: Gesa Riedewald: „Cannabis-Neubewertung: einheitliche EU-Position?“, abrufbar unter: [folgt eine URL]).
Cannabisblüten und Cannabisharz soll stattdessen nur noch in der Liste der weniger gefährlichen Drogen der Anlage I aufgeführt werden. Auch die Europäische Kommission unterstützt diese Forderung, was die medizinische Anwendung von Cannabis deutlich erleichtern wird, für den Freizeitkonsum aber keine Veränderungen bedeutet.
e) Höchstrichterliche internationale Rechtsprechung zum Umgang mit Cannabis
Verschiedene Bundesverfassungsgerichte und Oberste Gerichte rund um den Globus haben entschieden, dass Gesetze, die den Besitz von Drogen verbieten, nicht mit dem Menschenrecht auf ein Leben in Würde vereinbar sind, welches als „Respekt für die Autonomie einer Person“ beschrieben werden kann (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 13 m. w. N.). Als in Mexiko zum Beispiel vier Personen keine Lizenz zum Anbau von Cannabis für den Eigengebrauch erhielten, entschied das Oberste Gericht 2015, dass ein System, das mit administrativen Hürden den Freizeitkonsum von Cannabis unterbindet, verfassungswidrig sei. Es führte an, dass es sich dabei um einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Prinzip der Menschenwürde und in die freie Entfaltung der Persönlichkeit im Speziellen handelte (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 13, mit weiteren Nachweisen zum Volltext der Entscheidung, Fn. 16).
Gerichte in Chile, Spanien, Kolumbien und Argentinien haben benfalls geurteilt, dass der private Konsum von Drogen nicht vom Staat sanktioniert werden sollte. Das chilenische Oberste Gericht hat in einem Fall von Cannabisanbau zum Beispiel festgehalten, dass der Gesetzgeber zu Recht den Eigengebrauch von Sanktionen ausgenommen hatte. Das Gericht befand dies übereinstimmend mit dem Recht auf Autonomie, welches auch die eigenverantwortliche Selbstgefährdung erlaubt. Diese Urteile sind bezeichnend für eine sich verändernde Rechtslandschaft, in welcher die Bestrafung von Drogenkonsum und -besitz nicht länger mit dem Prinzip der Menschenwürde vereinbar ist. Für das Prinzip der Menschenwürde ist es von grundlegender Bedeutung, dass der Staat den Konsum von Drogen – letztlich keine Handlung, die anderen Schaden zufügt oder deren Rechte beschneidet – nicht als Einmischungsgrund in die Privatsphäre gelten lässt (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 15).
Am 18.09.2018 hat das südafrikanische Verfassungsgericht das dortige Cannabisverbot für verfassungswidrig erklärt (Spiegel Online vom 18.09.2018 , Urteil des Verfassungsgerichts Südafrika erlaubt privaten Marihuanakonsum, abrufbar unter [folgt eine URL]; siehe auch Zeit Online vom 18.09.2018, Südafrika legalisiert privaten Konsum und Anbau von Marihuana, abrufbar unter [folgt eine URL]). Das Urteil erging einstimmig mit Verweis auf die Verletzung des Grundrechts auf Privatsphäre und das Scheitern des „Krieges gegen Drogen“.
Bereits im November 2015 erklärte der Oberste Gerichtshof Mexikos das dortige Cannabisverbot für verfassungswidrig, um der Drogenmafia eine wesentliche Einnahmequelle zu nehmen. Die Entscheidung fiel durch ein Eins-zu-vier-Votum (Wirtschaftswoche vom 08.11.2015, Mit freiem Marihuana gegen die Mafia, abrufbar unter [folgt eine URL]). Die Cannabisprohibition ist in Mexiko gesetzlich seit dem 22.02.2019 beendet.
f) Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit
Die Weltkommission beklagt sich über die Wirkungen fehlender Normenanerkennung auf den Rechtsstaat. Rechtsstaatlichkeit setzt die Bereitschaft der Bürger voraus,
| „... die allgemeingültigen Gesetze zu respektieren und nicht gegen sie zu verstoßen, auch wenn sie nicht mit ihnen einverstanden sind“ (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 15, m. w. N. in Fn. 19). |
Diese Bereitschaft ist bei den Drogenstrafgesetzen offensichtlich nicht vorhanden, wie Hunderte von Millionen Menschen beweisen, die jedes Jahr Drogen konsumieren (Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 1 und XII). Drogenkonsum ist geschlechter-, ethnien-, klassen- und berufsübergreifend, und ein großer Teil der Gesellschaft betreibt ihn als normale Freizeitbeschäftigung. Das Risiko, dafür ins Gefängnis zu kommen oder einen Strafregistereintrag zu erhalten, scheint nur wenige von dem Vergehen abzuhalten, einem Vergehen, das im Wesentlichen niemand anderem schadet.
Man könnte sogar sagen, dass die Bestrafung des Drogenbesitzes und/oder -konsums der Glaubwürdigkeit des Strafgesetzes schadet. Es gibt wahrscheinlich keine andere Straftat, die anderen keinen direkten und sofortigen Schaden zufügt und die so hart geahndet und gleichzeitig so oft begangen wird (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 15. m. w. N.).
Die Kommission führt aus, dass die weit verbreitete und andauernde Missachtung der Drogenstrafgesetze die Legitimation der staatlichen Akteure wie der Polizei infrage stellt. Dies gelte vor allem, wenn Drogenstrafgesetze bei einer kleinen Untergruppierung der Gesellschaft unverhältnismäßig hart durchgesetzt werden und die Bestrafungen dabei Arme und Minoritäten am stärksten trifft (Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016; The Economist vom 10.10.2015, Prosecuting Drug Offenders: A Matter of Class, abrufbar unter [folgt eine URL]). Eine solch ungerechte Anwendung des Gesetzes untergräbt die Prinzipien des Rechtstaates grundlegend – die Rechtsgleichheit aller Personen, und dass die Gesetzanwendung immer gleich, fair und unparteiisch ist – und belastet die Beziehung des Staates zu seiner Bevölkerung.
Die Kommission verweist weiter auf Länder, die auf eine Strafandrohung bei Drogenkonsum verzichten und die erwiesenermaßen keinen erheblichen Anstieg des Drogenkonsums verzeichnen (Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, Fn. 25). Das und die vermehrte Unterstützung der Entkriminalisierung verschiedener UN-Gremien sowie regionaler multilateraler Behörden lassen zusätzlich an den Argumenten für die Durchsetzung der strengen Drogengesetze zweifeln.
Der Bericht besagt, dass der schwindende Respekt für die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen das Potenzial hat, das Korruptionsrisiko zu erhöhen. Die Kommission kritisiert, dass die Staaten mit ihrem Entscheid, einen strafrechtlichen Ansatz zu verfolgen, sich bewusst aus der Verantwortung gezogen und einen hohen Preis dafür gezahlt haben; es entstand ein illegaler Drogenmarkt mit einem jährlichen Umsatz von 320 Milliarden US-Dollar. Er wird von Banden und kriminellen Organisationen kontrolliert, die sich einen blutigen Machtkampf liefern (vgl. Weltkommission für Drogenpolitik, Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work, 2014, abrufbar unter [folgt eine URL]). Die immensen finanziellen Mittel, die der Drogenhandel den kriminellen Organisationen in die Hände spielt, erlaubt es ihnen, Behörden im großen Stil zu korrumpieren, von der Polizei bis hoch zu den Gerichten und der Politik. Der Einfluss der kriminellen Organisationen ist gut dokumentiert. Sie infiltrieren und korrumpieren Staatsorgane und untergraben die Rechtsstaatlichkeit. Sie manipulieren zum Beispiel den Gesetzesvollzug und schmieren Beamte in Mexiko oder finanzieren Präsidentschaftskampagnen in Guinea-Bissau (vgl. West African Commission on Drugs, Not Just in Transit: Drugs, the State and Society in West Africa, 2014).
Die Staaten untergraben die Rechtsstaatlichkeit aber längst nicht nur durch die bereits erwähnte ungerechte Anwendung der Drogengesetze. Der unverhältnismäßige Fokus der Strafvollzugsbehörden auf die Kontrolle von Drogenkonsumierenden hat Opportunitätskosten generiert: Es werden für Drogendelikte auf den unteren Stufen Ressourcen verbraucht, die dann bei in der Bekämpfung schlimmerer Verbrechen fehlen (wozu der Bericht noch weiter ausführt).
Zudem moniert die Weltkommission, dass staatliche Akteure im Namen der Drogenkontrolle oft außerhalb der Gesetze operieren, wie das grausame Vorgehen des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte vor Augen führt: Sein Aufruf an die Gesellschaft, alle in den Drogenhandel involvierten Personen zu exekutieren, hat während seiner ersten Monate im Amt 2016 zu Tausenden von Morden geführt – darunter mutmaßlich zahlreiche außergerichtliche Hinrichtungen. Ähnliche Vorkommnisse, die den Respekt vor dem Rechtsstaat schwinden lassen: Polizeigewalt gegen Drogenkonsumierende; Inhaftierung mutmaßlicher Drogendelinquenten ohne Gerichtsverhandlung und Inhaftierung von Menschen ohne fairen Prozess zum Zweck einer erzwungenen „Drogentherapie“. All diese Beispiele weisen auf Menschenrechtsverletzungen hin, die im Namen der Drogenstrafgesetze begangen werden (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 15 m. w. N.).
Auch wenn die Hinweise auf außergesetzliche Exzesse vornehmlich auf die Philippinen und auch (nachfolgend) auf Mexiko blicken, ist für Deutschland einerseits die Frage zu stellen, ob außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes liegende Rechtsverletzungen in keiner Weise mit der Prohibition in der Bundesrepublik in Verbindung stehen; andererseits, ob die Tatprovokation im Bereich der polizeilichen Aufklärung des Betäubungsmittelhandels nicht Anlass dafür bietet, die Mittel zum Zweck auch vor diesem Hintergrund infrage zu stellen.
Die Weltkommission weist darauf hin, dass die Kriminalisierung des Drogenmarktes in Mexiko zu 160.000 Drogentoten geführt hat, die durch Gewalt der Kartelle und der Militarisierung der Drogenbekämpfung herbeigeführt wurden; dazu sind 280.000 vertriebene und 25.000 verschwundene Menschen während des sogenannten Drogenkrieges in der Zeit zwischen 2006 und 2014 zu beklagen (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 17). Diese Erwähnung ist nur scheinbar weit weg von der bundesrepublikanischen, hier erhobenen verfassungsrechtlichen Frage; die Erwähnung weist darauf hin, welche Interdependenzen die nationale Bekämpfung des Drogenhandels hat, der (mangels legaler Möglichkeit des Erwerbs) eine wesentliche Voraussetzung des Konsums und des Besitzes ist.
Die Kommission weist weiter auf eine Studie hin, die für das Vereinigte Königreich errechnet hat, „dass ein Cannabisdelikt im Strafregister die Lebenseinkünfte um geschätzte 19 Prozent schmälern könnte“ (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 20 Rn. 83).
Die Kommission sieht zudem Beweise dafür, dass ein erster Kontakt mit dem Strafrechtssystem zu Wiederholungstaten führen kann. Betrachtet man das Ausmaß der Polizeiaktionen gegen Drogenbesitzdelikte, ist es vertretbar, von einem „Einstiegseffekt“ zu sprechen, der die Rückfälligkeit erhöht (Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, ebenda und Rn. 84; in diesem Zusammenhang auch: Möller zur Labeling Theorie, S. 183ff.).
Kofi Annan führt in dem Bericht an (Weltkommission 2016, S. 20):
| „Ich wiederhole mich, aber ich sage es heute noch einmal: Ich bin der Ansicht, dass Drogen viele Leben zerstören, aber falsche Regierungspolitiken haben noch viele mehr zerstört. Ein Strafregistereintrag für ein kleines Drogendelikt kann für junge Menschen eine viel größere Gefährdung ihres Wohlergehens bedeuten als der gelegentliche Drogenkonsum.“ |
Die Weltkommission gelangt daher zu der Empfehlung, die Kriminalisierung von Drogenbesitz und Drogenkonsum zu beenden.
Der Bericht stellt klar, dass internationale Vereinbarungen einer nationalen Entkriminalisierung nicht entgegenstehen. Zitiert wird das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den illegalen Handel mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen von 1988. Es verlangt von den Staaten zwar, dass sie den Besitz kriminalisieren, aber nur sofern „die [nationalen] Verfassungsgrundsätze und das Grundverständnis ihres Justizwesens“ es erlauben. Staaten dürfen die Kriminalisierung des Besitzes also aus Verfassungs- oder Menschenrechtsgründen unterlassen (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 22).
Die Kommission verweist weiter darauf, dass Jurisdiktionen, die den Besitz und/oder den Konsum von Drogen nicht bestrafen, keinen Anstieg des Drogenkonsums verzeichnen. Im Jahr 2014 hat eine Studie in elf Staaten mit unterschiedlichen Ansätzen die Drogenpolitik untersucht. Sie zeigte „keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen einer harten Strafverfolgung bei Drogenbesitz und dem Ausmaß des Drogenkonsums“ (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 22, Rn. 87 und 88; UK Home Office, Drugs: International Comparators, UK Government, 2014, abrufbar unter [folgt eine URL]; zur Datenlage auch: Möller S. 141ff., 149 ff.).
Der Bericht blickt auf die Entwicklung in den Niederlanden, wo auch der Konsum harter Drogen nach der Entkriminalisierung des Drogenbesitzes zurückgegangen ist (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 23), den Rückgang sozialer Kosten und Einsparungen im Strafrechtssystem in Portugal (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 24) und ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern. Die Kommission fordert darüber hinaus auch Alternativen zur Bestrafung kleiner Akteure des Drogenhandels (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 26 ff.).
Die Kommission gelangt zu dem Schluss, dass die Regierungen der nationalen Staaten im Ergebnis illegale Drogen regulieren müssen und zwar von der Produktion bis zum Vertrieb, um die Schäden, die von einem wirkungslosen und gefährlichen Krieg gegen die Drogen verursacht werden, vollständig zu eliminieren (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 33).
g) Erkenntnisse zu den Gefahren des Drogenmarktes – ökonomische Effekte der Prohibition
In einer vom Hanfverband in Auftrag gegebenen Studie befassen sich Prof. Dr. Justus Haucap u. a. mit den Nutzen- und Nachfragefunktionen suchterzeugender Substanzen am Beispiel des Cannabis (Haucap , Die Kosten der Cannabis-Prohibition in Deutschland, 2018).
Haucap u. a. ordnen Cannabis als eine Substanz, deren Konsum abhängig machen kann, in eine Kategorie mit legalen Suchtmitteln wie Alkohol und Tabak sowie anderen illegalen Drogen ein. Aus ökonomischer Perspektive weisen Drogen im Vergleich zu herkömmlichen Gütern einige Besonderheiten auf. Zwar können gängige ökonomische Konzepte prinzipiell gleichermaßen auf Drogen angewendet werden wie auf alle anderen Güter auch. Eine Besonderheit ergibt sich in Bezug auf Drogen jedoch dadurch, dass von ihnen ein (mehr oder weniger ausgeprägter) Suchtfaktor ausgeht und die typischerweise vorliegende negative Korrelation zwischen dem Preis eines Produktes und seiner Nachfrage nicht immer mehr vorliegt. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass suchtaufweisende Konsumgüter eine zu herkömmlichen Gütern verschiedene Nutzenfunktion haben, in der der gegenwärtige Nutzen vom vergangenen Konsum abhängt (vgl. Haucap 2018, S. 12 m. w. N.). Durch den Konsum der Substanz wird der Gegenwartsnutzen zulasten des Zukunftsnutzens maximiert.
Mit anderen Worten: Es wird eine spätere Erkrankung aufgrund des Konsums in Kauf genommen, um jetzt die Wirkung der Substanz spüren zu können. Eine bereits hohe (Konsum-)Prävalenz führt mitunter zu einer (weiter) steigenden Prävalenz, da der aus dem Konsum entstehende Nutzen mit der Zeit abnimmt und nur durch einen Mehrkonsum steigt.
Dieses Phänomen wird in der ökonomischen Konsumforschung zu Drogen als „rationale Abhängigkeit“ („rational addiction“) bezeichnet. Konsumenten, die eine solche Nutzenentwicklung aufweisen, zeigen sich naturgemäß unelastisch in Bezug auf eine vorübergehende Preiserhöhung, d. h. sie reagieren sehr träge auf Preiserhöhungen (vgl. Haucap 2018, a. a. O. m. w. N.)
Diese besondere Nutzenfunktion suchtaufweisender Konsumgüter hat ganz wesentliche Implikationen für die Drogenpolitik. Aus einer rein ökonomischen Perspektive führt eine Prohibition, durch die die Kosten der Schwarzmarktanbieter und damit prinzipiell auch die Schwarzmarktpreise erhöht werden, demnach nicht notwendigerweise zu einer Verringerung des Konsums, sondern vielmehr zu einer Erhöhung der Konsumausgaben. Becker u. a. (Becker, Gary S./Murphy, Kevin M./Grossmann, Michael, The Market for Illegal Goods: The Case of Drugs, University of Chicago und City University of New York, Journal of Political Economy 2006, S. 38 ff., im Folgenden zitiert als: Becker u. a.) führen aus, welche Implikationen dies für verschiedene Politikoptionen hat. Vereinfacht ausgedrückt wird gezeigt, dass ein verschärftes Durchsetzen eines Drogenverbotes höhere Kosten bei den Schwarzmarktanbietern verursacht, da mehr Ressourcen aufgewendet werden müssen, um nicht ertappt und bestraft zu werden. Diese angebotsseitigen (höheren) Kosten schlagen sich in höheren Schwarzmarktpreisen nieder und damit in höheren Ausgaben auf Konsumentenseite. Unter der vereinfachenden Annahme, dass auf dem Drogenmarkt Wettbewerb herrscht und sich die Anbieter konstanten Produktionskosten gegenübersehen, würden Anbieter durch den Verkauf der Drogen keine Gewinne realisieren. Die Gesamtausgaben für den Konsum reflektieren in dieser Situation gerade den Wert der Ressourcen, den Drogenhändler in die Produktion und die Bereitstellung von Drogen stecken.
Dies wiederum bedeutet, dass verschärfte polizeiliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Prohibition dazu führen, dass auf der Angebotsseite noch mehr Ressourcen in die Produktion und die Bereitstellung von Drogen gesteckt werden, selbst wenn die Nachfrage sinkt. Eine Legalisierung und Besteuerung von Konsumausgaben führt hingegen, so führen Haucap u. a. aus, zu Einnahmen des Staates. Diese Einnahmen bei einer Legalisierung stellen die Ressourcenkosten bei der Prohibition dar (in Form von höheren Kosten der Drogendealer).
Insgesamt stellt die Prohibition damit aus gesellschaftlicher Sicht ein deutlich teureres Instrument dar als eine wirksame Besteuerung, da Steuern keine (gesellschaftlichen) Kosten im eigentlichen Sinne darstellen, sondern vielmehr Transferzahlungen vom Konsumenten zum Staat (vgl. Haucap 2018, S. 13 m. w. N.).
Die Annahme vollständigen Wettbewerbs auf dem Drogenmarkt, bei dem keine Gewinne realisiert werden, kann in der realen Welt zwar nicht unterstellt werden. Dennoch hat die Analyse von Becker u. a. auch unter weniger utopischen Annahmen wichtige Implikationen für politische Maßnahmen im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Die verschärfte Durchsetzung einer Prohibition führt zu Risikoaufschlägen im Preis und damit zu hohen Gewinnen aufseiten der Anbieter. Dies wiederum hat zur Folge, dass Drogendealer mehr Aufwand betreiben (beispielsweise Korruption, Bestechung oder Gewaltanwendung), um nicht erwischt zu werden, da die realisierbaren Gewinne größer sind. Durch die hohen Gewinne werden außerdem risikofreudige Anbieter angezogen, wie etwa die Mafia, Terrorgruppen oder sonstige organisierte Gruppen, die diese hohen Gewinne abschöpfen wollen. Die Bekämpfung der Drogenkriminalität erhöht also die Margen beim Drogenhandel und hat damit paradoxerweise den Effekt, dass zum einen noch mehr skrupellose und risikofreudige Anbieter angezogen werden und zum anderen, dass der Drogenhandel mit mehr Aufwand, d. h. professionalisierter und krimineller betrieben wird, um nicht erwischt zu werden. Der Analyse von Becker u. a. zufolge ist der Kampf gegen die Drogenkriminalität schwierig bzw. kaum zu gewinnen (vgl. Becker u.a. 2006, S. 38 ff., S. 59; so auch Haucap 2018, S. 13 m. w. N.).
Haucap u. a. befassen sich weiter mit Angebot und Nachfrage auf den illegalen Drogenmärkten und führen aus, dass es auf nicht legalisierten Drogenmärkten wie auf jedem anderen Markt Anbieter und Nachfrager gibt. Eine Besonderheit illegaler Märkte im Vergleich zu gewöhnlichen Märkten besteht darin, dass Verträge nicht mit staatlicher Gewalt durch Gerichte durchgesetzt werden können. Aus diesem Grund haben sich auf illegalen Drogenmärkten andere Durchsetzungsmechanismen entwickeln, wie z. B. „private“ Gewalt.
Der Drogenhandel basiert zu großen Teilen auf Vertrauen, nicht selten vor dem Hintergrund von Gewaltandrohungen zwischen Händlern und Großhändlern. Die Angebotsseite zeichnet sich dadurch aus, dass Anbieter primär an Profiten und somit margenstarken Produkten interessiert sind. Die Gewinne im Drogenmarkt sind insgesamt (inklusive Großhandel) aufgrund von Monopol- und Kartellbildung typischerweise hoch und ziehen Konkurrenz an. Wettbewerb findet nicht – wie auf legalen Märkten – über den Preis und Qualität statt, sondern nicht selten mit Gewalt. Haucap u. a. weisen darauf hin, dass die hohen Gewinnaussichten zum einen starke Anreize zu Innovationen (z. B. neuartige Drogen wie Legal Highs, Deep Internet etc.), zum anderen aber auch zu Betrug bieten – beispielsweise in der Form, dass Substanzen mit sogenannten „Streckmitteln“ bearbeitet werden, die nicht selten gesundheitsschädlich oder gar giftig sind. Zwischen Anbietern und Nachfragern bestehen meist erhebliche Informationsprobleme, was die Qualität der Drogen betrifft.
Konsumenten können die Qualität ex-ante nur schwer erkennen und Anbieter wissen in der Regel mehr über die Qualität ihrer Ware als die Nachfrager. Hieraus resultieren teilweise erhebliche Qualitätsprobleme, die gegebenenfalls mit hohen Gesundheitsrisiken einhergehen können. Haftungs- und Informationspflichten vonseiten der Anbieter gibt es nicht. Zwar können teilweise Reputationseffekte und Mund-zu-Mund-Propaganda von Bedeutung sein, wodurch zumindest eine gewisse Qualitätskontrolle ermöglicht wird. Dies betrifft jedoch insbesondere den Teil des Schwarzmarktes, auf dem Akteure regelmäßig aufeinandertreffen.
Für den großen Teil des einmaligen Aufeinandertreffens spielen derartige Mechanismen eine nur sehr untergeordnete Bedeutung. Ein wirksamer Verbraucher- und Jugendschutz ist unter einer Prohibition kaum zu gewährleisten. Drogendealer haben oftmals keine hohen Opportunitätskosten, d. h., sie haben keine guten Alternativen anderweitig Geld zu verdienen, mit der Folge, dass sie meist relativ skrupellos sind und auch bereit sind, hohe rechtliche Risiken einzugehen (vgl. Haucap 2018, S. 14 m. w. N.). Die Nachfrageseite zeichnet sich durch eine relativ starke Heterogenität aus. Nachfrager sind typischerweise (je nach Droge) relativ preisunsensibel, d. h. sie reagieren kaum auf Preiserhöhungen (Haucap 2018, a.a.O.).
Den ökonomischen Analysen Haucaps u. a., aber auch Beckers u.a. zufolge ist das strafbewehrte Verbot des Erwerbs und des Besitzes von Cannabis kaum messbar geeignet, den Erwerb, den Besitz und den Konsum zu minimieren. Stattdessen befeuert das strafbewehrte Verbot die Gewinnmargen des illegalen Drogenmarktes.
Auch die Weltkommission für Drogenpolitik führt in mehreren Berichten seit 2012 aus, dass es eine falsche Annahme ist, dass Beschlagnahmungen, Festnahmen und strafrechtliche Verurteilungen im Zusammenhang mit Drogen sowie weitere gängige Gradmesser des ‚Erfolgs‘ der Drogenrepression dazu beitragen, die Verfügbarkeit von illegalen Drogen zu verringern. Daten des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zeigen, dass das weltweite Angebot an illegalen Opiaten wie Heroin in den letzten Jahrzehnten um mehr als 380 Prozent zugenommen hat: Der Bericht der Weltkommission von 2012 berichtet von einem Anstieg von 1.000 Tonnen im Jahr 1980 auf über 4.800 Tonnen im Jahr 2010. Parallel zu dieser Erhöhung sank der Heroinpreis in Europa zwischen 1990 und 2009 um 79 Prozent (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 4, S. 14).
Auch aus den Daten der Drogenüberwachung der Vereinigten Staaten ergeben sich ähnliche Hinweise darauf, dass sich das Drogenangebot mit dem Drogenkrieg nicht einschränken lässt. Zum Beispiel wurden seit den frühen 1980er Jahren die Bundesmittel zur Drogenbekämpfung in den Vereinigten Staaten um mehr als 600 Prozent aufgestockt, während der Heroinpreis in diesem Zeitraum um rund 80 Prozent sank und der Reinheitsgrad des Heroins sich um mehr als 900 Prozent erhöhte. Ein ähnliches Muster mit sinkenden Drogenpreisen und einer zunehmenden Stärke der Drogen geht aus den Überwachungsdaten der USA zu Kokain und Cannabis hervor (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 2). Wie bei der Alkoholprohibition in den USA in den 1920er Jahren heizt die weltweite Drogenprohibition heute die Gewalt im Drogenmarkt rund um den Globus an. So wird geschätzt, dass seit der militärischen Eskalation des Vorgehens gegen die Drogenkartelle, die 2006 durch die mexikanischen Regierungstruppen eingeleitet wurde, über 50.000 Menschen getötet wurden (Stand 2012); im Bericht von 2016 wird von einer Zahl von 160.000 Toten in der Zeit zwischen 2006 und 2014 gesprochen.
Befürworter von aggressiven Strafverfolgungsstrategien im Drogenbereich, so der Bericht der Weltkommission, gehen möglicherweise davon aus, dass ein Blutvergießen dieses Ausmaßes dem Drogenmarkt die Möglichkeit nimmt, illegale Drogen herzustellen und zu vertreiben.
Kürzlich vorgenommene Schätzungen weisen jedoch darauf hin, dass die Heroinproduktion in Mexiko seit 2004 um mehr als 340 Prozent zugenommen hat (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 2).
Cannabis stand im Mittelpunkt des Kriegs gegen die Drogen, den die US-Regierung seit Jahrzehnten führten. Unter Berücksichtigung der Stärke und inflationsbereinigt ging der Cannabispreis in den Vereinigten Staaten seit 1990 um 33 Prozent zurück, während die Stärke von Cannabis um 145 Prozent anstieg. Das National Institute on Drug Abuse der Vereinigten Staaten gelangte zum Schluss, dass Cannabis während der letzten 30 Jahre der Cannabisprohibition für amerikanische Jugendliche der zwölften Schulstufe fast generell verfügbar blieb. Zwischen 80 und 90 Prozent dieser Jugendlichen gaben übereinstimmend an, diese Droge sei „sehr einfach“ oder „recht einfach“ zu beschaffen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen bestätigt diese Analyse für Deutschland in vielen Stellungnahmen und Empfehlungen (vgl. Dem Cannabiskonsum wirksam begegnen, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Beschluss des Vorstandes vom 18.05.2004: Das gegenwärtige Strafrecht ist den Beweis seiner Konsum begrenzenden Effektivität über Jahrzehnte schuldig geblieben; abrufbar unter: [folgt eine URL]).
Insgesamt weisen diese Indikatoren klar darauf hin, dass die Ausgaben zur Drogenbekämpfung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar praktisch keine Auswirkungen auf das gesamte Drogenangebot hatten (wie verschiedene Indikatoren belegen, die auf eine zunehmende Produktion, abnehmende Preise und eine steigende Stärke der Drogen hinweisen). Mit diesen Mitteln hatte man versucht, das Drogenangebot durch kostspielige politische Handlungskonzepte, Festnahmen und Verbote zu unterbinden (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 16 m. w. N.).
Aus der Auswertung empirischer Daten geht hervor, dass die Drogenrepression keinen Rückgang des Drogenkonsums bewirkt, sondern unter Umständen genau den gegenteiligen Effekt hat. In den Vereinigten Staaten gibt ein Achtel der jungen Erwachsenen an, ihr leiblicher Vater sei zu irgendeinem Zeitpunkt inhaftiert gewesen. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Inhaftierung des Vaters und dem Drogenkonsum der betreffenden Jugendlichen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie des familiären Hintergrunds und individueller Merkmale. Diese unbeabsichtigten Auswirkungen des Kriegs gegen die Drogen auf Familien erklären möglicherweise, weshalb beispielsweise die Raten des Cannabiskonsums in manchen Staaten der USA nach wie vor höher sind als in Portugal, wo der Konsum von Cannabis entkriminalisiert wurde, oder als in den Niederlanden, wo auch der Verkauf von Cannabis praktisch legalisiert wurde (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 17 m. w. N.; vgl. auch zum umgekehrten Effekt und den Instanzen informeller sozialer Kontrolle: Möller, S. 202ff.)
An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass dem Staat aufgrund der Cannabisgesetzgebung jährlich Steueraufkommen und eingesparte Kosten durch eine Legalisierung von Cannabis bei einer konservativ durchgeführte Berechnung in Höhe von 2,5 Milliarden € zuzüglich der Kosten für Justiz ( Gerichte, Staatsanwaltschaften, Strafvollzug ) entgehen. Haucap u.a. haben in der bereits erwähnten Studie ( vgl. Seite 8 ), ohne die Kosten für Justiz zu berechnen, die Gesamtkosten genau mit 2.668.603.574 € berechnet. So für Cannbissteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Sozialversicherungsaufkommen und eingesparte Polizeikosten. Hinzu kommen sicherlich Einsparungen bei der Justiz in einem hohen dreistelligen Millionenbetrag so dass sicher von einer Gesamtsumme weit über 3 Milliarden €, die die Prohibition kostet, ausgegangen werden kann. Dieses Geld könnte bei einer Legalisierung, insbesondere für Präventionsarbeit und Behandlung derjenigen, die tatsächlich ein Suchtproblem entwickelt haben, vernünftiger eingesetzt werden (vgl. insoweit auch die Ausführungen zur Erforderlichkeit S. 92).
h) Nationale Forderungen zur Abschaffung der Cannabisprohibition
Die internationalen Entwicklungen haben auch die nationalen Diskussionen befördert bzw. werden auch von diesen beeinflusst. Das Amtsgericht Bernau hat nach 1994 im Jahr 2002 eine erneute Richtervorlage an das Bundesverfassungsgericht adressiert. Eine weitere Vorlage war im Jahr 2004 geplant (vgl. StraFO, 2005 S. 40 f.). Die neue Richtervereinigung hat sich gegen die Prohibition und für eine regulierte Freigabe von Cannabis positioniert (Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zum Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG), BT−Drucks. 18/4204). Neben der Rechtsprechung sind es die strafrechtliche Lehre – der Schildower Kreis – und auch die verschiedene Initiativen im Bundestag (so die Gesetzgebungsinitiativen der Partei Die Grünen, der FDP und der LINKEN), die das Ende der Cannabisprohibition verlangen.
aa) Resolution der Strafrechtsprofessorinnen und -professoren
Über 120 Strafrechtsprofessorinnen und -professoren haben sich 2013 zusammengefunden und eine Resolution verabschiedet, die eine erneute Überprüfung der Wirksamkeit, der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der normativen Angemessenheit des Betäubungsmittelgesetzes fordert. Sie sehen die Erfolglosigkeit der strafrechtlichen Bekämpfung der Drogennachfrage, die exorbitanten Gewinne, die Verbrechen und Terror finanzierten, und die Regulierungstendenzen in den Niederlanden, Spanien, der Schweiz und Portugal als Anlass für die Forderung.
Sie halten die Drogenprohibition für gescheitert, sozialschädlich und unökonomisch. Sie sehen in der Prohibition die Aufgabe des Staates, seine Kontrolle über Verfügbarkeit und Reinheit von Drogen auszuüben. Sie sehen den Zweck der Prohibition für verfehlt an, sie halten sie für gesellschaftlich schädlich, weil sie den Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität fördere (vgl. Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und –professoren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, abrufbar unter [folgt eine URL]).
bb) Weitere Stimmen
Der Resolution der Strafrechtsprofessorinnen und -professoren hat sich die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin im Februar 2015 angeschlossen. Auch der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, plädiert für eine regulierte Legalisierung von Cannabis (vgl. [folgt eine URL]). In einer Umfrage vom Februar 2018 unter 858 Haus- und Fachärztinnen und - ärzten haben 53 Prozent für eine Legalisierung gestimmt, während nur 12 Prozent ein komplettes Cannabisverbot befürworteten (vgl. [folgt eine URL]).
Die Neue Richtervereinigung hat zum Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG), BT−Drucks. 18/4204 eine die Entkriminalisierung befürwortende und eine Regulierung des Cannabismarktes fordernde Stellungnahme abgegeben (vgl. Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zum Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG), BT−Drucks. 18/4204).
An dieser Stelle ist auch auf die Kommentierung vor § 52 StGB in Fischer, Strafgesetzbuch, 63. Aufl. 2018 Rn. 13a hinzuweisen. Dort führt Fischer, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, aus, dass eine
| „unvoreingenommene, rationale Betrachtung (…) nicht länger ignorieren“ |
sollte,
| „dass die Prohibitionspolitik von Rauschmitteln kriminalpolitisch, aber auch strafrechtlich gescheitert ist. Eine Gesellschaft, die 5 Prozent ihrer Mitglieder wegen des Konsums von Rauschmitteln kriminalisiert, während sich zugleich weitere 30 Prozent der Bevölkerung legal und staatlich gefördert totsaufen oder -rauchen, verhält sich evident irrational.“ |
Die Bundestagsfraktion der Grünen (Die Grünen) hat am 20.02.2018 wiederholt (zuletzt am 04.03.2015) einen Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes vorgelegt (vgl. Cannabis Regulierungs Gesetz, BT Drs. 19/819). Zur Begründung haben Die Grünen ausgeführt, dass die Prohibitionspolitik im Bereich von Cannabis vollständig gescheitert ist. Darauf hingewiesen wird, dass Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Droge ist. In Deutschland gebrauchen nach Schätzungen allein 3,1 Millionen volljährige Bürgerinnen und Bürger Cannabis (vgl. BT Drs. 19/819; Epidemiologischer Suchtsurvey 2015). Der Anteil der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren, die schon einmal Cannabis konsumiert haben, ist seit 2011 angestiegen (von 6,7 auf 8,8 Prozent). Von den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren haben 35,5 Prozent Cannabis konsumiert (vgl. BT Drs. 19/819; Aktuelle Zahlen rund um Sucht, Eine Zusammenstellung der Fachstellen für Suchtprävention Berlin, gGmbH, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Dabei praktiziert die Mehrzahl der volljährigen Konsumentinnen und Konsumenten keinen riskanten Gebrauch von Cannabis. Die geltende Rechtslage führt bei ihnen in der Konsequenz zu einer unverhältnismäßigen Kriminalisierung. So verzeichnete das Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität 2016 des BKA auf Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik 145.915 konsumnahe Delikte im Zusammenhang mit Cannabis. Für Volljährige sei das bisherige Verbot – auch verglichen mit anderen legalen Substanzen wie beispielsweise Alkohol – daher ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihre Handlungsfreiheit, weil der Konsum lediglich eine Selbstgefährdung darstellt.
Als Lösung haben die Grünen vorgeschlagen, Cannabis aus den strafrechtlichen Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes herauszunehmen. Stattdessen soll ein strikt kontrollierter legaler Markt für Cannabis eröffnet werden. Damit werde dem Schutz von Minderjährigen besser Rechnung getragen als bisher, da erst in einem solchen Markt das Verbot, Cannabis an Minderjährige zu verkaufen, wirksam überwacht werden kann. Eine gute Cannabispolitik reguliere den Cannabismarkt so, dass sowohl der Jugendschutz gestärkt werde als auch die Risiken möglichst stark reduziert würden.
Auch die Bundestagsfraktion der FDP sprach sich in ihrem Antrag vom 24.01.2018 (BT Drs. 19/515) dafür aus, Modellprojekte für den freien Cannabis-Konsum zu ermöglichen. Der Kampf gegen den Cannabiskonsum durch Repression sei gescheitert. Es sei deshalb an der Zeit, neue Wege in der Suchtprävention zu beschreiten, argumentiert die Fraktion. Ziel muss es sein, die Verbreitung von Cannabis zu kontrollieren und den Gesundheits- undJugendschutz in der Bevölkerung zu verbessern.
Schließlich legte auch die Bundestagsfraktion der Linken am 21.02.2018 einen Entwurf vor.
Auch die Linke sieht die Verbotspolitik im Bereich Cannabis als gescheitert an. Cannabis sei die am häufigsten konsumierte illegale Droge, heißt es in ihrem Antrag „Gesundheitsschutz statt Strafverfolgung – Für einen progressiven Umgang mit Cannabiskonsum“ (BT Drs. 19/832). Dem stehe eine auf Verbote setzende Drogenpolitik gegenüber, die ideologisch motiviert sei und an der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger vorbeigehe. Die Fraktion fordert, den Besitz von Cannabis zum Eigenbedarf zu erlauben und die Säulen der Suchtprävention, Beratung und Behandlung in der Drogenpolitik gegenüber der Säule der Repression und Stigmatisierung zu stärken.
Die Anträge der Oppositionsfraktionen im Bundestag wurden mit der Regierungsmehrheit der Abgeordneten von SPD und CDU/CSU abgelehnt.
Auch in der Regierungspartei SPD – hier der Berliner Landes-SPD – wird verschiedentlich die Beendigung der Prohibition und die Regulierung des Cannabiskonsums gefordert. In der Berliner Zeitung vom 20.04.2018 fordert der Berliner Fraktionschef der SPD die Entkriminalisierung. Das Cannabisverbot habe sich nicht bewährt, Strafen hätten nichts bewirkt (vgl. [folgt eine URL]).
Zuletzt hat sich die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag für eine andere Cannabispolitik ausgesprochen.
So erklärte die SPD Fraktion im Deutschen Bundestag in einem Positionspapier, dass sie eine Abkehr von der bisherigen Cannabis- Verbotspolitik in Deutschland beschlossen habe. Nach Ansicht der SPD Fraktion sollte der Besitz kleiner Mengen an Cannabis zum Eigenverbrauch nicht mehr strafrechtlich verfolgt, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit behandelt werden. Auch sollten Modelprojekte ermöglicht werden, in denen die legale und regulierte Abgabe von Cannabis an Konsumenten erprobt wird. Dies hatten in den letzten Jahren auch einige deutsche Städte wie Düsseldorf, Münster, Bremen, Berlin Kreuzberg und zuletzt das Bundesland Berlin gefordert. Diesbezügliche Anträge wurden aufgrund der bestehenden Gesetzeslage durch das zuständige Bundesinstitut für Arznei und Medizinprodukte bisher regelmäßig abgelehnt. Zuletzt der Antrag des Bundeslandes Berlin im Jahre 2020.
Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, das sich mittlerweile die Zustimmung der Bevölkerung bezüglich einer Entkriminalisierung des Umgangs mit Cannabis auch gewandelt hat. So sprachen sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Dimap im Jahre 2019 44 % für eine Entkriminalisierung aus. Im Jahr 2018 sogar 46 %. Hier zeigt sich der Wertewandel in der Gesellschaft.
3. Entscheidungserheblichkeit der neuen Tatsachen
Bei den dargestellten Entwicklungen handelt es sich um entscheidungserhebliche neue Tatsachen, welche zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 noch nicht vorlagen und eine erneute Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der vorgelegten Normen erforderlich machen. So ist eine erneute Vorlage insbesondere nicht ausgeschlossen, wenn tatsächliche oder rechtliche Veränderungen wie zuvor dargelegt eingetreten sind, die die Grundlagen der früheren Entscheidung berühren und deren Überprüfung nahelegen (vgl. BVerfGE 87,341,346). Hierfür können bereits veränderte gesellschaftliche Anschauungen ausreichend sein (vgl. insoweit BVerfGE 39,169,182).
Der Gesetzgeber unterliegt einer Beobachtungs-, Prüfungs- und Nachbesserungspflicht (vgl. BVerfGE 65, 1, 55 f.; 88, 303, 309 f.), er muss auf deutliche Veränderungen in der soziopolitischen Wirklichkeit und in der Wissenschaft, erst recht auf Fehlfunktionen eines Gesetzes reagieren (siehe auch Möller S. 101 Fn. 511 m. w. N.).
Der Gesetzgeber kann aufgrund veränderter Umstände zur Überprüfung und Nachbesserung einer ursprünglich verfassungsgemäßen Regelung gehalten sein. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn sich eine bei Erlass des Gesetzes verfassungsrechtlich unbedenkliche Einschätzung des zugrundeliegenden Wirklichkeitsausschnitts später als ganz oder teilweise unzutreffend erweist (vgl. BVerfGE 90, 145 (219 f.)).
Auch wenn der Gesetzgeber insofern hinsichtlich der Gefahreneinschätzung lediglich eingeschränkter Kontrolle unterliegt, ist nunmehr nach 26 Jahren seit der letzten verfassungsrechtlichen Entscheidung und den aufgezeigten neuen nationalen und internationalen Entwicklungen und Erkenntnissen im Hinblick auf den Cannabiskonsum die Cannabiswirkung, die Gefahren der Prohibition und die Möglichkeiten der Regulierung eine Neuüberprüfung der vorgelegten Vorschriften unbedingt geboten.
Dabei geht die Vorlage davon aus, dass die vom Bundesverfassungsgericht in seiner früheren Entscheidung – BVerfGE 90, 145 – gebilligte Konzeption des Gesetzgebers,
| „den gesamten Umgang mit Cannabisprodukten mit Ausnahme des Konsums selbst wegen der von der Droge und dem Drogenhandel ausgehenden Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit einer umfassenden staatlichen Kontrolle zu unterwerfen und zur Durchsetzung dieser Kontrolle den unerlaubten Umgang mit Cannabisprodukten lückenlos mit Strafe zu bedrohen“, |
heute nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
Die erneute Anrufung des Bundesverfassungsgerichts ist vor allem auch deswegen geboten, weil der Gesetzgeber zu einer Aufgabe seiner bisherigen Drogenpolitik aus eigener Kraft nicht imstande zu sein scheint. In der derzeit vorherrschenden irrationalen Drogenpolitik kann sich das bessere, an verfassungsrechtlichen Vorgaben orientierende Wissen nicht ohne weiteres gegen politische und ideologische Interessen jenseits einer Sachlösung durchsetzen.
B. Begründetheit der Hauptvorlage
Die hier grundsätzlich anzuwendende Strafvorschrift des § 29 Abs. I Nr.1 BtMG i.v.m. mit der Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG, die den unerlaubten Erwerb von Cannabisprodukten in geringer Menge mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bedroht, verstößt gegen Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG sowie Art. 3 Abs. 1 GG sowie Art.6 Abs.1 und 2 GG.
Art. 2 Abs. 1 GG schützt alle Formen menschlichen Handelns und Verhalten ohne Rücksicht darauf, welches Gewicht der Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung zukommt (vgl. BVerfGE 6,32,36;54,143,146;80,137,152 ff; 90, 145 171 und zuletzt in dem sogenannten Sterbehilfe Urteil vom 26.02.2020 - 2 BvR 2347/15 - ). Die allgemeine Handlungsfreiheit ist in den Schranken des zweiten Halbsatzes des Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet und steht damit unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen Ordnung. Wird Freiheitsstrafe angedroht, so ermöglicht dies einen Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG geschützte Grundrecht der Freiheit der Person. Die Freiheit der Person, die das Grundgesetz als „unverletzlich“ bezeichnet, ist jedoch ein so hohes Rechtsgut, dass in sie aufgrund des Gesetzesvorbehalts des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG nur aus besonders gewichtigen Gründen eingegriffen werden darf (BVerfGE 90, 145 (172) m. w. N. Darüber hinaus verstößt die Aufnahme von Cannabisprodukten in die Anlage I zu § 1 Abs.1 BtMG mit der Folge, dass der unerlaubte Verkehr von Cannabisprodukten mit Geld oder Freiheitsstrafe bedroht ist, im Hinblick auf die Ungleichbehandlung mit Alkohol gegen Art. 3 Abs. 1 GG .Und schließlich verstößt die gegenwärtige Gesetzeslage auch gegen Art 6 GG, da der Staat seiner Verpflichtung nicht nachkommt, Jugendliche und ihre Familien zu schützen.
1. Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG
Durch die Aufnahme von Cannabis in Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes stellt der Gesetzgeber jedwede Handlungen, die dem Konsum von Cannabis notwendigerweise vorausgehen oder ihn begleiten, nämlich Anbau, Erwerb, Besitz, Veräußerung und Einfuhr, unter Strafe. In dem vorliegend vom Gericht zu entscheidenden Sachverhalt führt die Anwendung von § 29 Abs. 1Nr.1 BtMG dazu, dass der Erwerb von 2,6 g Mariuhana zum Eigenverbrauch zwangsläufig zur Verhängung einer Geld - oder Freiheitstrafe durch das zuständige Gericht führt. Ein Verstoß gegen Art. 2 Abs.1 GG liegt zur Überzeugung des Amtsgerichts vor.
Artikel 2 Abs. 1 GG schützt alle Formen menschlichen Verhaltens unabhängig davon, in welchen Grad sie zur Entfaltung der Persönlichkeit beitragen (vgl. BVerfGE 6, 32, 36 ; 54, 143, 146 ; 80, 137, 152 ff und zuletzt im sogenannten Sterbehilfe Urteil vom 26.02.2020 zu 2 BVR 2347/5 Rdnr.207). In der Entscheidung vom 26.02.2020 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass Artikel 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz das Recht gewährleistet, dass der Einzelne seine Identität und Individualität selbst bestimmt finden, entwickeln und wahren kann. Namentlich, so das Bundesverfassungsgericht, setzte selbst die bestimmte Wahrung der eigenen Persönlichkeit voraus, dass der Mensch über sich nach eigenen Maßstäben verfügen kann und nicht in Lebensformen gedrängt wird, die in einem unauflösbaren Widerspruch zum eigenen Selbstbild und Selbstverständnis stehen. Im Rahmen der zuvor zitierten Entscheidung nimmt das Bundesverfassungsgericht an verschiedenen Stellen auch Bezug auf die bereits wiederholt zitierte Cannabisentscheidung aus dem Jahre 1994. Seinerzeit stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass der Umgang mit Cannabisprodukten nicht zum absolut geschützten Kernbereich des Grundrechts gehöre, da der Umgang mit Cannabis und das sich Berauschen hiermit aufgrund seiner vielfältigen sozialen Wechselwirkung über den Kernbereich der Persönlichkeitsentfaltung hinausgehe. Hiernach nach sei dem Gesetzgeber von Verfassungswegen nicht grundsätzlich untersagt auch den Cannabiskonsum zu regeln (vgl. BVerfGE 90, 155, 171). Es führte sodann weiter aus, dass allerdings alle eingreifenden Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes, Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung sein müssten und mithin den ungeschriebenen Verfassungsgrundsetzen sowie Grundentscheidungen des Grundgesetzes entsprechen müssten; sie müssten insbesondere verhältnismäßig sein. Letzteres ist zur Auffassung des Gerichts heute jedenfalls nicht mehr gegeben. Bereits hier soll im Hinblick auf die im Jahr 1994 vorgenommenen Wertung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 90, 145 (171)) – hervorgehoben werden, dass sich der Umgang mit Cannabis mitnichten auf das Berauschen reduziert. Vielmehr dient der Umgang mit Cannabis – wie bereits ausführlich dargelegt – u. a. der Steigerung des Appetits, der Ermöglichung des Schlafs, der einfachen Erholung, der Entspannung, der Vertiefung von Wahrnehmungen und Empfindungen sowie der Selbstbehandlung vermeintlicher oder tatsächlicher Erkrankungen von Mensch und Tier oder auch als Bestandteil religiöser Zeremonien (vgl. hierzu u.a. Prof. Dr. Nestler, Cornelius: Cannabis und die verantwortungsbewusste Freiheit, Editorial in: Strafverteidiger, 2019, Heft 4, S. I; Möller, S. 98 f., 114 ff., 122). Insofern wird durch das Cannabisverbot nicht lediglich in die äußere Sphäre der allgemeinen Handlungsfreiheit, sondern durchaus in sensible Bereiche der privaten Lebensgestaltung eingegriffen, die deutlich kernbereichsnah sind (so wohl auch Möller, S. 99). Dies gilt es bei der folgenden Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit zu berücksichtigen.
In materieller Hinsicht bietet – vorbehaltlich besonderer verfassungsrechtlicher Gewährleistungen – der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit den allgemeinen verfassungsrechtlichen Maßstab, nach dem die Handlungsfreiheit eingeschränkt werden darf. Nach diesem Grundsatz muss ein grundrechtseinschränkendes Gesetz geeignet und erforderlich sein, um den erstrebten, legitimen Zweck zu erreichen. Ein Gesetz ist geeignet, wenn mit seiner Hilfe der erstrebte Erfolg gefördert werden kann; es ist erforderlich, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte wählen können (vgl. BVerfGE 90, 145 (172) m. w. N.).
Schließlich darf das Gesetz nicht gegen das Übermaßverbot verstoßen. Bei der vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geforderten Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit des gewählten Mittels zur Erreichung des erstrebten Zwecks sowie bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Einschätzung und Prognose der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gefahren steht dem Gesetzgeber ein Beurteilungsspielraum zu, welcher vom Bundesverfassungsgericht nur in begrenztem Umfang überprüft werden kann (BVerfGE 90, 145 (173).
Das so beschriebene Verhältnismäßigkeitsprinzip muss dabei im Bereich der Strafverfolgung durch den Staat besonders strikte Anwendung finden. Denn die Androhung, Verhängung und Vollziehung von Strafen bringen als Sanktionen von besonderem Ernst den Vorwurf zum Ausdruck, der Täter habe „elementare Werte des Gemeinschaftslebens verletzt" (vgl. BVerfGE 45, 187 (253)). Aufgrund des daraus folgenden besonders intensiven Eingriffscharakters darf das Strafrecht nur als letztes Mittel angewandt werden (vgl. BVerfGE 90, 145 (213); Hassemer, Winfried, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität (OrgKG), KJ 1992, S. 64 f.). Rechtsstaatliches Strafrecht unter der Geltung der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes ist deshalb notwendig „fragmentarisch“. Schon der Androhung von Strafe kommt – neben ihrer Verhängung und Vollziehung – als Grundrechtseingriff besonderes Gewicht zu (vgl. hierzu auch: abweichendes Votum Sommer, BVerfGE 90, 145 (213)).
Bei einer verfassungsmäßigen Überprüfung strafrechtlicher Vorschriften kommt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine gesteigerte Bedeutung zu (vgl. BVerfGE 6,289,433 FF;39,1,47;88,203,258 ).
In der modernen, aufgeklärten Kriminalwissenschaft besteht seit der 1975 abgeschlossenen Großen Strafrechtsreform Einigkeit über folgende Prinzipien verfassungskonformen Strafrechts (vgl.: Böllinger, Lorenz, Strafrecht, Drogenpolitik und Verfassung, KJ 1991, S. 393, S. 398 f.):
Pönalisiert werden dürfen nur sozialschädliche und sozialgefährliche Verhaltensweisen. Nicht dagegen solche, die der grundrechtlich gewährleisteten Selbstbestimmung des Bürgers unterliegen oder solche, die gegen abstrakte, kulturelle Werte, staatliche Ziele oder irgendwie definierte Sittlichkeit oder Moral verstoßen. Der Einsatz von Strafrecht darf immer nur das letzte Mittel sein.
Nur spezifisch umschriebene und empirisch belegbare, das soziale Unwerturteil rechtfertigende spezifisch tatbestandstypische Gefahren dürfen pönalisiert werden. Gefährlichkeit oder Schädlichkeit sowie Kausalität des betreffenden Verhaltens bedürfen des empirischen Nachweises.
Auch unter der Prämisse nachgewiesener Gefährlichkeit darf die Strafbarkeit gegenüber Unrechtsgehalt und Schädlichkeit nicht als Überreaktion erscheinen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist oberster Verfassungsmaßstab. Der Einsatz des Strafrechts muss unabhängig vom Einzelfall als geeignet, erforderlich und proportional gewertet werden können. Die Regulierung von sozialen Problemen durch das Strafrecht muss wegen der besonderen Intensität der Grundrechtseinschränkung äußerstes Mittel der Sozialpolitik und ultima ratio im gesetzgeberischen Instrumentarium bleiben. Außerstrafrechtliche Alternativen haben Vorrang.
Im Sinne einer Folgenanalyse muss die Gesetzgebung durch das Strafrecht selbst bewirkte Sekundärschäden mit dem Nutzen abwägen und eventuell auf Kriminalisierung verzichten.
Der Strafgesetzgeber muss mit zeitgerechten wissenschaftlichen Standards prüfen, ob sein Unwerturteil sich mit den wandelbaren Werteüberzeugungen der Bevölkerung so weit deckt, dass mit der Folgebereitschaft der Bürger zu rechnen ist.
Schließlich ist ein wesentlicher Grundsatz des Strafrechts, dass nur Fremdverletzungsunrecht erfasst werden soll. Der Selbstmord und die Selbstschädigung sind straffrei (vgl. u.a. Böllinger, Lorenz, Die Obsoletheit des Cannabisverbots, Beitrag zur Expertenanhörung Sitzung Gesundheitsausschuss des Bundestages, 25.06.2018, S. 5 f. – im Folgenden zitiert als Böllinger 2018; hierzu auch Möller S. 47 ff. vgl. insoweit auch 2 BvR 2347/15 amtliche Leitsätze).
Wendet man diese Maßstäbe auf die hier zur Prüfung vorgelegten Normen an, ist festzustellen, dass die vorliegend angegriffenen Vorschriften des Betäubungsmittelstrafrechts gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie das Übermaßverbot i. e. S. verstoßen und damit verfassungswidrig sind.
a) Legitimer Zweck
Der Gesetzgeber verfolgt mit dem derzeit geltenden Betäubungsmittelgesetz und dem daraus folgenden strafbewehrten Umgangsverbot, der in den Anlagen aufgeführten Substanzen, mithin auch Cannabis, ebenso wie mit dessen Vorläufern verschiedene Zweckrichtungen.
Zunächst soll durch die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes, die „Volksgesundheit“, d. h. die menschliche Gesundheit sowohl des Einzelnen wie der Bevölkerung im Ganzen vor den von Betäubungsmitteln ausgehenden Gefahren geschützt werden sowie das gesellschaftliche Zusammenleben in einer Weise gestaltet werden, die es von sozialschädlichen Wirkungen des Umgangs mit Drogen frei hält. Insbesondere Jugendliche sollen vor der (psychischen) Abhängigkeit von Betäubungsmitteln bewahrt werden (vgl. die Begründungen der Regierungsvorlage zum Betäubungsmittelgesetz 1971, BR Drucks. 665/70 [neu], S. 2 und die Regierungsvorlage des Betäubungsmittelgesetzes 1981, BT-Drucks. 8/3551, S. 23 f.; sowie BVerfGE 90, 145 (174) m. w. N.).
Weiter sollen durch die Vorschriften des BtMG – entsprechend den internationalen Abkommen – der unerlaubte Verkehr mit Betäubungsmitteln verhindert und damit die transnationale organisierte Kriminalität, welche durch den Handel mit Betäubungsmittel hohe finanzielle Gewinne und Reichtümer erwirtschafte, bekämpft sowie eine Untergrabung der rechtmäßigen Wirtschaft verhindert werden (vgl. Präambel des Suchtstoffübereinkommens 1988; BVerfGE 90, 145 (175 f.)).
aa) Gefährdung der Volksgesundheit
In der Strafrechtswissenschaft ist bereits umstritten , ob es sich bei dem Schutz des Universalrechtsguts der Volksgesundheit grundsätzlich um einen legitimen Zweck einer Strafvorschrift handelt (vgl. u.a. Böllinger 2018, S. 5; Möller, S.55). Dies kann jedoch vorliegend dahingestellt bleiben , da mangels nachgewiesener gravierender potenzieller physischer, psychischer sowie sozialer Risiken – im Hinblick auf den Umgang mit Cannabis die Gefährdung derVolksgesundheit nicht mehr als legitimer Zweck angeführt werden kann (vgl. hierzu Krumdiek, Nicole, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 25.01.2012 – Legalisierung von Cannabis durch Einführung von Cannabis-Clubs – BTDrucks. 17/7196 – im Folgenden zitiert als SN-Krumdiek 2012).
Oben wurde bereits ausführlich zur Frage der Auswirkungen und der Gefährlichkeit von Cannabiskonsum vorgetragen. Entscheidend – und durch die Unterstützer der Cannabisprohibition vielfach verkannt – ist hierbei, dass bei der Beurteilung der Gefährlichkeit des Umgangs mit Cannabis immer von einem „Normalkonsumenten“ ausgegangen werden muss. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaft wohnt jedoch einem moderaten Cannabiskonsum – so wie er von der überwiegenden Mehrheit der Konsumenten praktiziert wird – keine besondere Gefährlichkeit im Hinblick auf die physischen, psychischen und sozialen Folgen für den Einzelnen inne. Insbesondere als widerlegt gilt die Annahme, dass Cannabis als Einstiegsdroge den Weg in die Welt der Rauschgifte ebnet. Kein seriöser Wissenschaftler vertritt heute noch die These von der Einstiegsdroge. Ebenfalls als widerlegt muss heute die Behauptung angesehen werden, dass Cannabiskonsum ein sogenanntes amotivationales Syndrom hervorrufe. Es finden sich kaum noch Stimmen, die mit diesem Argument die Cannabisprohibition rechtfertigen.
Dass es bestimmte Risikogruppen gibt, beispielsweise junge Menschen, Dauerkonsumenten und Menschen mit psychischen oder physischen Vorerkrankungen, für welche der Konsum von Cannabis erhebliche Folgen haben kann, kann an der im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Prüfung zugrunde zu legende objektive Bewertung nichts ändern.
Soweit Gefahren für den einzelnen, insbesondere jugendlichen Konsumenten verbleiben, sind diese Gefahren letztlich immer auch auf das geringe Alter und den Entwicklungsstand der Jugendlichen zurückzuführen. Jeder junge Mensch ist im Rahmen der gesellschaftlichen Sitten und Moralvorstellungen einer Vielzahl von Gefahren ausgeliefert. Als Beispiele seien genannt: übermäßiger Konsum von Videos/TV, übermäßiger Konsum von Computerspielen, übermäßiger Konsum von Schokolade und Zucker, übermäßiger Konsum von Alkohol, Betreiben gefährlicher Sportarten, Teilnahme am Straßenverkehr und schließlichMedikamenten- und Nikotinmissbrauch. Die mit dem Cannabiskonsum einhergehenden Gefahren dürften für Jugendliche letztlich nicht höher einzustufen sein als das übermäßige Gebrauchen oder Nutzen anderer Stoffe und Produkte. Wenn dem aber so ist, so ist auch der Konsum von Cannabis letztlich ein Teil der bei jedem jungen Menschen vorhandenen allgemeinen Tendenz, in seiner Jugend Fehler zu begehen und Risiken einzugehen – also, zu lernen. Dennoch bleibt es dem Gesetzgeber vorbehalten, den Umgang mit Cannabis auf Volljährige zu begrenzen. Trotz der relativ geringen Gefahr ist es unstreitig, dass eine Freigabe von Cannabis für Jugendliche nicht in Betracht kommt (vgl. dazu u.a. Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zum Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG), BT Drucks. 18/4204 – Das Cannabis-Strafrecht darf in der geltenden Form keine Zukunft haben, Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, Ausschuss-Drs. 18(14)0162(16) – im Folgenden zitiert als SN-Neue Richtervereinigung zu BT-Drucks. 18/4204; anders Möller, der sich für eine Freigabe von Cannabis ab 16 Jahren ausspricht, da ansonsten eine Kriminalisierung von Jugendlichen zu befürchten ist (vgl. Möller, S.228)).
Zu demselben Ergebnis kommt auch das schweizerische Bundesgericht in seiner Entscheidung vom 29.08.1991 (StV 1992, 18, 19), in der es feststellt:
„Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse lässt sich somit nicht sagen, dass Cannabis geeignet sei, die körperlich und seelische Gesundheit vieler Menschen in eine nahe liegende oder ernstliche Gefahr zu bringen. Der Sachverständige Prof. Dr. Dee hat erklärt, dass Cannabis nach seiner Erkenntnis das Rauschmittel mit den geringsten individuellen gesamtgesellschaftlichen Wirkungen sei, dass es zurzeit auf der Welt gebe. Binder hat in seinem Aufsatz im deutschen Ärzteblatt (1981, 124) ausgeführt:
|
Die gemachten Ausführungen müssen in besonderem Maße für den hier einschlägigen Tatbestand des § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG in Form des Erwerbens geringer Mengen zum Eigenkonsum gelten, da hier die behauptete Gefährdung der Bevölkerung sowie des gesellschaftlichen Zusammenlebens allenfalls als abstrakte Gefahr herangezogen werden kann. Jedenfalls bei der Tatbestandsvariante des Erwerbens und des damit verbundenen Besitzes ist vielmehr unmittelbar lediglich eine – nach geltender Strafrechtsdogmatik – straflose Selbstgefährdung zu befürchten. Zwar führt das Bundesverfassungsgericht 1994 aus, dass bereits der unerlaubte Erwerb und Besitz fremde Rechtsgüter gefährde, weil sie die Möglichkeit einer unkontrollierten Weitergabe der Droge an Dritte eröffnen. Auch soll nach dieser Auffassung die Gefahr einer Weitergabe selbst dann bestehen, wenn der Besitz der Droge nach der Vorstellung des Täters nur dem Eigengebrauch dienen soll. Zudem sei gerade im Erwerb zum Zwecke des Eigengebrauchs die Nachfrage verwirklicht, die den illegalen Drogenmarkt am Leben erhalte (vgl. BVerGE 90, 145, 187 m. w. N.). Es bleibt aber auch danach bei einer lediglich abstrakten Gefahr und zwar unter dem bereits ausführlich dargelegten Gesichtspunkt eines für den Normalverbraucher verhältnismäßig ungefährlichen Stoffs. Die Einschätzung des BVerfG von 1994 beruht daher auf der damals vorherrschenden Annahme der verhältnismäßig hohen Gefährlichkeit; sie beruht zudem auf der großenteils widerlegten Annahme, durch Repression seien die Nachfrage nach Cannabis einzudämmen, die Gefahren des illegalen Drogenmarktes effektiv einzuschränken, den Schutz von Kindern und Jugendlichen und somit der Familien ebenso zu bewirken wie den der Vulnerablen, weil psychisch Vorbelasteten. Selbst wenn man die Kritik unberücksichtigt lässt, wonach sich die Schaffung von abstrakten Gefährdungsbegriffen nur noch schwer mit der verfassungsrechtlich legitimierten Strafrechtsdogmatik in Einklang bringen lässt (vgl. zu einer grundlegenden Kritik der Dogmatik des Betäubungsmittelstrafrechts: Böllinger 2018, S. 5 f.), müssen abstrakte Gefährdungsdelikte jedenfalls eine wissenschaftliche Grundlage für die Annahme von potenziellen Rechtsgutsgefährdungen haben. Daran aber fehlt es hier.
bb) Gefährdung des sozialen Zusammenlebens
Das über die Gefährdung des Einzelnen hinausgehende formulierte Ziel eines sozialen Zusammenlebens in Freiheit von Abhängigkeit und Drogengefahr beinhaltet letztlich die Forderung nach Drogenabstinenz in der Gesellschaft (vgl. Kniesel, Michael, nach der Entscheidung des BVerfG zur Strafbarkeit weicher Drogen – Anfang vom Ende der Drogenpolitik durch Strafrecht, ZRP 1994, S. 352, S. 355). Dieses Ziel ist jedoch nicht nur illusionär (Kniesel, ZRP 1994, S. 352, S. 355 m.w.N.), sondern auch kein verfassungskonformes Ziel. Mit diesem Ziel erhebt sich der Gesetzgeber schließlich zum Hüter einer bestimmten Moralvorstellung und Gesinnungsethik, wie man es Jahrzehnte auch bezüglich der strafrechtlichen Homosexuellenverfolgung gemacht hat; das Cannabisstrafrecht würde weiter zur Setzung überkommener Moralvorstellungen missbraucht werden (vgl. hierzu auch Möller, S.51 f., 129). Solche Methoden widersprechen jedoch einem demokratischen Rechtsstaatverständnis.
cc) Regulierung des Drogenmarktes
Im Hinblick auf das Ziel einer allgemeinen Regulierung des Drogenmarktes sowie insbesondere der Bekämpfung internationaler Drogenkartelle mag es sich grundsätzlich um einen legitimen Zweck handeln, der jedoch als Legitimation für die Bestrafung des Einzelnen, als Instrumentalisierung des Betroffenen bereits erhebliche Bedenken im Hinblick auf Art. 1 Abs. 1 GG, nämlich die Menschenwürde, aufwirft (vgl. BVerfGE 90, 145, 220 f.; Böllinger 2018 S. 6). Im Übrigen handelt es sich wie die Geschichte zeigt um einen seit Jahrzehnten andauernden untauglichen Versuch.
3. Zusammenfassung
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die seinerzeit bei Begründung der Cannabiskriminalisierung zielstehenden Erwägungen heute objektiv nicht mehr als zutreffend bezeichnet werden können. Dem Gesetzgeber steht damit kein legitimer Zweck im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips zur Seite, der den durch die Strafbarkeit erfolgten Eingriff in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz rechtfertigen könnte. Wenn aber wie vorliegend kaum noch Zweifel dahingehend bestehen, dass von einem letztlich einzubindenden Rauschmittel nur ganz geringe Gefahren und nur für Wenige ausgehen und diese bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einmal wissenschaftlich deutlich belegt sind, dürfte schließlich die Beweislast für die Gefährlichkeit, die eine Rechtfertigung in das Freiheitsrecht von Millionen von Bürgern rechtfertigen, beim Gesetzgeber liegen. Dieser ist verpflichtet, tatsächlich vorhandene Risiken darzulegen (so bereits Schneider betrifft Justiz, 2001, 37, 45). Die Strafrechtsgesetzgebung darf unter Berücksichtigung einer modernen Verfassung nicht den Selbstzweck der Gesetzgebung geopfert werden.
b) Geeignetheit
Sofern man jedoch zugunsten des Gesetzgebers den Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger und die Strafandrohung bezüglich des Umgangs mit Cannabisprodukten noch mit dem heutigen Wissen noch gerade eben für rechtmäßig erachtet und einen legitimen Zweck bejahen würde, ist dieser Eingriff jedenfalls nicht geeignet das angedachte Ziel zu erreichen.
So sind die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetztes, soweit der Umgang mit Cannabis unter Strafe gestellt wird, jedenfalls nicht geeignet, die gesetzgeberischen Ziele – ob legitim oder nicht – zu fördern. Die dem Strafrecht zugrundeliegenden allgemein anerkannten Strafzwecke der positiven und negativen Spezial- und Generalprävention gehen im Hinblick auf den pönalisierten Umgang mit Cannabis und die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele fehl.
aa) Scheitern der Prohibition
Das Ziel der Prohibition, die Verbreitung einer Droge in der Gesellschaft einzuschränken und damit die vermeintlich verbundenen Gefahren im Gesamten zu verringern, ist jedenfalls im Hinblick auf den Umgang mit Cannabis gescheitert (vgl. hierzu u. a. Prof. Dr. Nestler, Cornelius: Cannabis und die verantwortungsbewusste Freiheit, Editorial in: Strafverteidiger, 2019, Heft 4, S. I; Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und –professoren an die Abgeordneten des deutschen Bundestages, 2013, abrufbar unter: [folgt eine URL] – im Folgenden zitiert als Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und -professoren 2013; BT-Drucks. 19/819; BT-Drucks. 19/832; BT-Drucks. 19/515; siehe auch den Beschluss des Vorstandes der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen vom 18.05.2004: Das gegenwärtige Strafrecht ist den Beweis seiner Konsum begrenzenden Effektivität über Jahrzehnte schuldig geblieben).
Seit bald 50 Jahren ist Cannabis trotz aller Verschärfungen zunehmend leichter, in größeren Mengen sowie billiger denn je verfügbar (vgl. Böllinger 2018, S. 6) und wird zudem im Wirkstoffgehalt immer potenter (vgl. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2012, S. 14). So gehen Schätzungen dahin, dass 20 bis 30 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland Cannabis bereits probiert haben, und dass die Droge regelmäßig von bis zu vier Millionen Menschen konsumiert wird. Im Falle des Verbots des Umgangs mit Cannabis liegen mittlerweile gesicherte Kenntnisse dahingehend vor, dass das Verbot nicht konsumhindernd wirkt, also kein konkreter Zusammenhang zwischen Verbot und Konsumverhalten besteht (vgl. u. a. Polizeipräsident in Münster, Hubert Wimber auf der Fachtagung „Cannabispolitik im europäischen Vergleich" vom 03.06.02 unter Bezug auf Kerner, Kriminalistik 1993, S. 19-28; Schneider, Wolfgang, Risiko Cannabis? Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, Band 5, 1995; sowie Möller S. 141 ff., 149 ff.). Die Zahl der Konsumentendelikte nehme jährlich um 5 bis 8 Prozent zu (Böllinger 2018, S.6).
Auch international herrscht mittlerweile weitgehende Einigkeit darüber, dass der „Krieg gegen die Drogen“ gescheitert ist. So berichtet etwa die Weltkommission für Drogenpolitik im Juni 2011, dass sie den weltweiten Krieg gegen die Drogen für gescheitert erachte und dass die nationale wie auch die weltweite Drogenpolitik einer dringenden grundlegenden Reform bedarf (vgl. hierzu die obigen Ausführungen.).
bb) Negativeffekte
Dagegen führt das Verbot von Cannabis zu zahlreichen Negativeffekten, welche den vom Gesetzgeber formulierten Zwecken diametral entgegenstehen (vgl. dazu u. a. SN-Neue Richtervereinigung zu BT Drucks. 18/4204; Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und -professoren 2013; Berichte der Weltkommission für Drogenpolitik 2011, 2012, 2016).
Erst durch die Kriminalisierung und damit die Verhinderung eines legalen Marktes werden der Schwarzmarkt, u. a. auch der Verkauf über das sogenannte Darknet, sowie die dahinterstehenden Strukturen der organisierten Kriminalität ermöglicht und gefördert. Durch die Legalisierung von Cannabis würde dem illegalen Markt dagegen ein wesentliches Produkt und damit eine zentrale Einnahmequelle entzogen (vgl. hierzu Becker u.a. 2006, S. 38 ff., S. 59; Haucap 2018, S. 13 m. w. N.; Zobel/Marthaler 2016, S. 13 f.; Berichte der Weltkommission für Drogenpolitik 2011, 2012, 2016).
Die Verdrängung von Cannabis auf den illegalen Drogenmarkt führt zu einer Vermischung der Drogenmärkte verschiedener Substanzen. So haben Dealer neben Cannabis häufig auch andere Betäubungsmittel, wie etwa MDMA oder Kokain im Angebot und auch ein wirtschaftliches Interesse an deren Verkauf. Personen, die zunächst lediglich an dem Ankauf von Cannabis interessiert waren, kommen so unfreiwillig in den Kontakt mit anderen, erheblich gesundheitsgefährdenden Drogen. Dieser Effekt wäre durch den legalen, staatlichen Vertrieb zu vermeiden.
Aufgrund der Prohibition gibt es keine wirksamen staatlichen Kontrollmechanismen für Herstellung, Verfügbarkeit und Reinheit des auf den Markt kommenden Cannabis.
Konsumenten werden durch den illegalisierten Konsum der Gefahr von Krankheiten ausgesetzt; die Herstellung, Verbreitung und der Konsum beispielsweise synthetischer Cannabinoide wie Legal Highs und sog. Badesalze wird begünstigt. Hierzu greifen Menschen, die, aufgrund der straf- und verkehrsrechtlichen Verfolgung vermeintlich straflose Handlungen begehen wollen. Den Drogen- und Suchtberichten der Bundesregierung sind für die Zeit von 2015 bis 2018 insgesamt 190 Todesfälle zu entnehmen. Wie viele Menschen durch die Einnahme solcher vermeintlich ungefährlicher Substanzen schwere Gesundheitsschädigungen aufwiesen bzw. auf Intensivstationen landeten enthalten die Berichte nicht. Darüber hinaus ist staatlich regulierter Verbraucher- und Jugendschutz nicht möglich, aber auch eine gesellschaftliche Aufklärung sowie ein Diskurs über die Risiken werden durch die Kriminalisierung erheblich erschwert. Die repressive Reaktion des Strafrechts ist dagegen in ihrer Wirkung eindimensional und wie aufgezeigt unwirksam. Es ist gerade der illegale Markt, der kein Interesse an Jugendschutz, an Gesundheitsschutz, an Aufklärung über Wirkstoffgehalt und dem Schutz vor Verunreinigungen hat – im Gegenteil:
Die Gefahren für vulnerable Käufergruppen sind auf dem illegalen Markt am größten (vgl. Zobel/Marthaler 2016, Becker u.a. 2006, Haucap u.a. 2018 in ihren jeweiligen Resümees).
Durch das strafrechtliche Verbot des Umgangs mit Cannabis werden Konsumenten – und damit ein erheblicher Teil der Bevölkerung – einer primären und sekundären Kriminalisierung ausgesetzt. Karrieren und Lebensläufe von ansonsten nicht-kriminellen Personen werden durch das Stigma einer strafrechtlichen Verfolgung erheblich beeinträchtigt oder sogar zerstört (vgl. hierzu Möller, S.183 ff.). Hierbei ist schließlich eine schicht- und migrationsspezifische Selektion zu beobachten, welche gesellschaftliche Diskriminierung, Ausgrenzung und Radikalisierung verstärkt (vgl. dazu u. a. Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 15 m. w. N.).
Die strafrechtliche Verfolgung des Umgangs mit Cannabis führt zu immensen Kosten sowie zur Bindung erheblicher personeller und dinglicher Ressourcen für Strafverfolgungsbehörden und Justiz (vgl. hierzu Zobel/Marthaler 2016, S. 15). So wurde etwa im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in insgesamt 179.700 (2019: 186.455) Fällen wegen Cannabis ermittelt (vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik 2018/2019, abzurufen unter: [folgt eine URL]). Gleichzeitig verzichtet der Staat auf potenzielle Steuereinnahmen in Milliardenhöhe (vgl. hierzu Haucap 2018, S. 8 sowie.). So betrugen etwa in Colorado die Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf im Steuerjahr 2014/2015 rund 78 Millionen US-Dollar (vgl. hierzu D.IV.).
Neben den Kosten für Staat und Allgemeinheit führt zudem die Kriminalisierung dazu, das die vorhandenen bereits knappen Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden im erheblichen Maße gebunden werden. Die Normentreue der Bürger wird unterminiert, wenn der Rechtsstaat sich mit der Durchsetzung nicht akzeptierter Verbote gegen sie richtet. Zudem fehlt es der Rechtspolitik an Glaubwürdigkeit, wenn derart geringe Normanerkennung bezüglich des Betäubungsmittelstrafrechts auch noch durch die Praxis der Strafverfolgungsbehörden Erosion erfährt, die einen inflationären Einsatz von V-Leuten, den Einsatz von sogenannten Agents Provocateurs sowie die Auflösung des Bestimmtheitsgebots in diesem Bereich erkennen lässt (vgl. Böllinger 2018, S. 7; Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik 2016, S. 15 m. w. N.;). Es dürfte mittlerweile Einigkeit in der Wissenschaft dahingehend bestehen, dass die Kriminalisierung nicht den geringsten Einfluss auf das Verbreiten oder Nichtverbreiten des Mittels Cannabis hat. Dies wird im übrigen durch internationale Vergleiche bestätigt (vgl. auch insoweit die Expertise des Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages WD-3000-072/19 ).
Vor diesem Hintergrund kann die Gesamtkonzeption des Gesetzgebers im Hinblick auf die Geeignetheit der Mittel zur Erreichung der angestrebten Zwecke – anders als noch durch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung von 1994 angenommen – nicht mehr vor der Verfassung Bestand haben. Vielmehr ist die Cannabiskriminalisierung und die Eindämmung der mit ihm in Zusammenhang stehenden geringen Gefahren nicht nur ungeeignet sondern wirken darüber hinaus in wesentlichen Aspekten dem durch den Gesetzgeber angestrebten Zweck entgegen.
C. Erforderlichkeit
Sofern man jedoch den Eingriff in das Freiheitsrecht des Bürgers noch als legitim und auch geeignet bewertet, so ist das strafbewehrte Verbot des unerlaubten Umgangs mit Cannabisprodukten jedenfalls nicht erforderlich, um die Ziele des Gesetzes zu erreichen.
Nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit ist der Gesetzgeber verpflichtet, unter mehreren möglichen gleichgeeigneten Regelungsalternativen diejenige zu wählen, welche den geringsten Eingriffscharakter hat.
Wie bereits dargelegt, ist das strafrechtliche Verbot des Umgangs mit Cannabis bereits ungeeignet, die vom Gesetzgeber benannten Zwecke zu erreichen. Gleichzeitig ist die strafrechtliche Sanktionierung von Verhalten, als ultima ratio, einer der schärfsten Eingriffe, die dem Staat gegenüber dem Einzelnen zur Verfügung stehen.
Demgegenüber stehen jedoch Regelungsalternativen durch verwaltungs- und privatrechtliche Regelungen, welche in ihrem Eingriffscharakter für den Einzelnen wesentlich geringer ausfallen und bei denen davon auszugehen ist, dass sie im Hinblick auf den Regelungszweck ein effektiveres Mittel darstellen.
So wurden im Jahr 2018 sowohl durch die Bundestagsfraktion der Grünen als auch durch die Bundestagsfraktion der Linken Gesetzesentwürfe vorgelegt, die alternative Gesetzeskonzepte zur Regelung des Umgangs mit Cannabis zum Inhalt haben (vgl. BT-Drucks. 19/819; BTDrucks. 19/832). Auch in der Resolution der 122 Strafrechtsprofessorinnen und – Professoren wird festgestellt, dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die Gefährdungen durch bislang illegale Drogen ebenso wie solche durch Medikamente und Alkohol besser durch gesundheitsrechtliche Regulierung mit akzessorischer ordnungs- oder strafrechtlicher Sanktionierung sowie mit adäquaten Jugendhilfemaßnahmen zu bewältigen wären.
aa) Sachgerechter Jugendschutz
So ist zunächst, um insbesondere Jugendliche vor dem Konsum dieser Droge zu bewahren, eine weit stärkere und ehrlich praktizierte Präventionsarbeit in den Schulen und Ausbildungsstätten das geringer eingreifende Mittel. Würde diese im weitaus größeren Umfang als bisher durch gut ausgebildete Pädagogen und Sozialarbeiter betrieben, bestünde zunächst die Möglichkeit, dass Jugendliche aufgrund der dann erworbenen Kenntnisse über einen verantwortungsvollen Umgang mit der Droge Cannabis Bescheid wüssten. Sie könnten sich darüber hinaus auch mit den Ursachen ihres Rauschmittelkonsums auseinandersetzen und möglicherweise ihre dahinterstehenden persönlichen Probleme erkennen und ohne Strafverfolgungsdruck angemessen verarbeiten. Die pauschale Pönalisierung des Umgangs mit Cannabis verhindert letztlich, dass der Staat seiner Verpflichtung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im erforderlichen Umfang nachkommt und führt darüber hinaus zu ungerechtfertigten Eingriffen in das elterliche Erziehungsrecht, sofern sich Jugendliche vor dem Jugendrichter zu verantworten haben (vgl. Art. 6 GG). Gleichzeitig würde eine Legalisierung von Cannabis Gespräche auch der Eltern über familiäre Zusammenhänge mit ihren Kindern fördern, da Cannabiskonsum nicht mehr unter dem Stigma der Illegalität stehen würde (zum Einfluss der Instanzen informeller sozialer Kontrolle auf die Konsumentscheidung Jugendlicher: Möller, S.202 ff.). Beispielsweise im Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz) könnte der Umgang mit dem Betäubungsmittel Cannabis unter Jugendschutzerwägungen sachgemäß geregelt werden. In diesem Rahmen stünde sodann die Möglichkeit offen, die generelle Abgabe des Betäubungsmittels Cannabis an Jugendliche weiter unter Strafe zu stellen, analog der Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche. Auch im Rahmen des Gaststättengesetzes bzw. der Gewerbeordnung wäre ein sachgerechter Jugendschutz hinsichtlich des Cannabiskonsums praktizierbar. Durch strikte Altersbegrenzungen für den Verkauf von Cannabis könnte der Zugang zur Droge für Jugendliche erstmals effektiv erschwert werden.
Mit diesen Möglichkeiten könnten die letztlich noch als verblieben zu betrachtenden Risiken im Bereich des Jugendschutzes besser, glaubwürdiger und schließlich auch verfassungsgemäß behandelt werden.
bb) Weitere Möglichkeiten der Regulierung
Dem Gesetzgeber stehen ferner das wesentlich mildere Mittel des Ordnungswidrigkeitsrechts als auch das Mittel des Gewerberechts zur Verfügung (zu Alternativen Regelungsmodellen vergleiche auch Möller, S.225 ff.). Er wäre des Weiteren in der Lage, über eine vernünftige Fiskalpolitik den Konsum des Betäubungsmittels Cannabis einzudämmen. So könnte über die hohe Besteuerung sehr wohl eine Verringerung des Cannabiskonsums erfolgen, wobei die legale Abgabe von Cannabis noch immer wesentlich preiswerter sein kann als auf dem illegalen Drogenmarkt (vgl. Zobel/Marthaler 2016, S. 13 m. w. N. zur Regelung in Washington-State). Auf diesem Wege wäre auch eine effektivere Kontrolle des verkauften Cannabis – insbesondere im Hinblick auf den THC-Gehalt – möglich.
Cannabis im Straßenverkehr könnte ebenfalls analog zu den Vorschriften bezüglich Alkohols im Straßenverkehrsgesetz und in der Straßenverkehrsordnung geregelt werden. Auch würden so nicht tausende von überwiegend jungen Menschen ihre Fahrerlaubnisse verlieren ohne dass sie tatsächlich unter aktuellen Einfluss des Betäubungsmittel Cannabis fahren.
cc) Internationaler Vergleich
Dass ein alternativer Umgang mit Cannabis möglich ist und mit der liberalisierten Zugänglichkeit oder Vergabe von bislang illegalen Drogen die befürchtete Ausweitung des Drogenkonsums ausbleibt, zeigt die seit 2014 im europäischen und nicht-europäischen Ausland erfolgte Teillegalisierung von Cannabis (vgl. oben ; Zobel/Marthaler 2016, S. 22 f. m. w. N.). Wie bereits ausführlich dargelegt, haben verschiedene Bundesstaaten der USA, Uruguay, die Niederlande, Spanien, Kanada, Luxemburg, Portugal und die Schweiz in verschiedenem Ausmaß und auf verschiedenen rechtlichen Wegen eine Liberalisierung ihrer Cannabispolitik vorgenommen und so dem illegalen Cannabismarkt einen legalen gegenübergestellt. Jedenfalls lässt sich die durch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahr 1994 geäußerte Befürchtung, die Bundesrepublik Deutschland könne aufgrund einer Legalisierung zu einem „neuen Mittelpunkt des internationalen Drogenhandels“ werden, durch die in anderen Ländern gemachten einschlägigen Erfahrungen nicht bestätigen vgl. auch Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages Bundestagsdrucksache WD 9-3000-072/19).
Schließlich zeigt ein Blick nach Österreich, dass insbesondere die Schärfe der Strafandrohungen, wie sie das deutsche Betäubungsmittelgesetz für den Umgang mit Cannabis vorsieht, nicht erforderlich ist. So sieht das österreichische Suchtmittelgesetz wesentlich geringere Strafrahmen für Betäubungsmitteldelikte vor (vgl. §§ 27-42 Suchtmittelgesetz Österreich, abrufbar unter [folgt eine URL]). Die unabdingbare Erforderlichkeit einer höheren Strafandrohung zum Schutze der Rechtsgüter des Betäubungsmittelgesetzes wäre aber nur dann gegeben, wenn in der Bundesrepublik eine andere Ausgangssituation herrschen würde als in Österreich – und zwar hinsichtlich der Rechtsgutsgefährdung bei Jugendlichen, hinsichtlich der Zahl der drogeninduzierten Straftaten, hinsichtlich der Zahl der Betäubungsmittelerkrankungen, der Gefahren für den Straßenverkehr und der Gefahren des Betäubungsmittelhandels. Eine derart abweichende Ausgangssituation ist jedoch nicht erkennbar. Eine verfassungsrechtliche Legitimation für die gewählten Strafrahmen bleibt der Gesetzgeber letztlich schuldig.
Eine Auswertung der jeweils praktizierten Regelungsmodelle und deren Auswirkungen kann und sollte zu einem fundierten, alternativen Gesetzeskonzept beitragen.
Insgesamt kommt auch das Amtsgericht Bernau bei Berlin in Übereistimmung mit der Resolution der Strafrechtsprofessoren, die auch ihren Studenten lehren, dass die Aufnahme von Cannabisprodukten in der Anlage 1 im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips nicht erforderlich ist, dazu, dass der Einsatz des Strafrechts nicht nur ungeeignet sondern auch nicht erforderlich ist. Dies zumal der Staat mit den bei einer Legalisierung eingesparten Milliarden (s. oben) sicher die angedachten Ziele, insbesondere Jugendschutz, wesentlich besser erreichen könnte.
d) Übermaßverbot
Das grundsätzliche Verbot des Umgangs mit Cannabisprodukten verstößt des Weiteren gegen das Übermaßverbot.
Insoweit muss eine Gesamtabwägung vorgenommen werden zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht sowie der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe, wobei die Grenze der Zumutbarkeit für die Adressaten des Verbots gewahrt bleiben muss. Im Bereich des staatlichen Strafens folgt aus dem Schuldprinzip, das seine Grundlage in Art. 1 Abs. 1 GG findet, und aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der aus dem Rechtsstaatsprinzip und den Freiheitsrechten abzuleiten ist, dass die Schwere einer Straftat und das Verschulden des Täters zu der Strafe in einem gerechten Verhältnis stehen müssen.
Eine Strafandrohung darf nach Art und Maß im Verhältnis zu dem unter Strafe stehenden Verhalten nicht schlechthin unangemessen sein. Tatbestand und Rechtsfolge müssen sachgerecht aufeinander abgestimmt sein (vgl. BVerfGE 90, 145 (173) m. w. N.).
aa) Umfassendes Verbot des Umgangs mit Cannabis
Das allgemeine Konzept des Gesetzgebers, den Umgang mit Cannabisprodukten – abgesehen von sehr engen Ausnahmen – umfassend zu verbieten, verstößt dort schon gegen das Übermaßverbot, wo es den Besitz auch geringer Mengen an Cannabis unter die Androhung einer Geld oder Freiheitsstrafe stellt, weil zum einen die relative Ungefährlichkeit eines moderaten Cannabiskonsums als wissenschaftlich gesichert angesehen werden muss und zum anderen – wie dargelegt – die Konzeption eines umfassenden Verbots nach nationalen sowie internationalen kriminologischen Erkenntnissen zur Erreichung der vom Gesetzgeber formulierten Ziele ungeeignet und ein derartig umfassender Eingriff in die Handlungsfreiheit des Einzelnen nicht erforderlich ist.
bb) Verbot mit Kriminalstrafe
Darüber hinaus verstößt das Verbot mit Kriminalstrafe – insbesondere in Form der Freiheitsentziehung – sowie die Gleichbehandlung von Cannabis mit anderen – in ihrer Schädlichkeit nicht vergleichbaren – Suchtstoffen wie beispielsweise Heroin, Crystal Meth oder Opium in eklatanter Weise gegen das Übermaßverbot.
Die Gefährdung der geschützten Güter kann ein so geringes Maß erreichen, dass die generalpräventiven Gesichtspunkte, die eine generelle Androhung der Strafe rechtfertigen, an Gewicht verlieren. Die Strafe könnte dann im Blick auf die Freiheitsrechte des Betroffenen und unter Berücksichtigung der individuellen Schuld des Täters und der sich hieraus ergebenden spezialpräventiven kriminalpolitischen Ziele eine übermäßige und daher unverhältnismäßige Sanktion darstellen (BVerfGE 90, 145 (185)). So aber liegt der Fall im Hinblick auf die neuen Erkenntnisse zur Frage der Gefährlichkeit von Cannabis und der Geeignetheit und Erforderlichkeit eines strafbewehrten Verbotes hier. Relevante Gefahren für die (volljährige) Allgemeinheit insgesamt oder auch für den (volljährigen) Einzelnen – welche die Verhängung einer Kriminalstrafe bei bloßem Besitz zum Eigenkonsum rechtfertigen würden – ergeben sich nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen durch den Konsum von Cannabisprodukten nicht. Die Androhung von Freiheitsstrafe ist in diesem Fall im Blick auf die Freiheitsrechte der Betroffenen und unter Berücksichtigung der individuellen Schuld eine übermäßige und verfassungswidrige Sanktion.
Zudem führt der durch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung von 1994 vorgeschlagene Weg zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit und Ungleichbehandlung der betroffenen Personen.
Hierbei muss das Bundesverfassungsgericht auch die Realitäten in den Gerichtssälen zur Kenntnis nehmen und in seine Abwägung miteinstellen. So wird in der Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zur BT-Drucks.: 18/4204 die Praxis der Rechtsprechung im Betäubungsmittelstrafrecht eindrücklich dargestellt:
| „Dort [in deutschen Gerichtssälen] werden noch immer die extrem weiten Strafrahmen des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG), das entsprechend seinem ,Geburtsfehler‘ nicht zwischen Cannabis und ,harten‘ Drogen wie Heroin etc. unterscheidet, oftmals in einer Härte angewandt, die sich unter keinem Gesichtspunkt (erst recht nicht unter dem des Rechtsgüterschutzes) in die sonstige Praxis der Strafgerichte einfügt. Es gilt für manche Strafgerichte offenbar noch immer: Entscheidend für die Strafzumessung ist die Menge der Betäubungsmittel. Dass es sich dabei um eine Ware handelt, deren Schädlichkeit in einem die umfassende Kriminalisierung legitimierenden Ausmaß mehr als fraglich ist, interessiert offenbar wenig. Das Betäubungsmittelstrafrecht wurde im Zuge einer ,Kriminalisierungshysterie‘ (vgl. Böllinger, Strafverteidiger 1996, S. 317, 320) mit Strafrahmen ausgestattet, die man sonst nur im Zusammenhang mit Tötungsdelikten und wenigen anderen schwersten Straftaten kennt. Wer sich etwa mit anderen zusammenschließt, um Cannabis in nicht geringer Menge nach Deutschland einzuführen, oder wer Cannabis als Mitglied einer Bande in nicht geringer Menge anbaut, hat nach § 30a BtMG eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren bis zu 15 Jahren zu gewärtigen. Aber auch, wer nicht im Rahmen einer ,Bande‘ handelt, erhält nach § 29a BtMG in diesen Fällen eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr (bzw. von zwei Jahren bei der Einfuhr, § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG) bis zu 15 Jahren. Eine beliebige, zufällige Auswahl aus der jüngsten Strafzumessungspraxis verschiedener Landgerichte:
Insgesamt werden pro Jahr mehr als 50.000 Personen nach dem BtMG verurteilt (die meisten davon wegen Umgangs mit Cannabis). Diese drastischen Strafen werden für ,Taten‘ ausgeurteilt, in denen es allenfalls um die Ermöglichung der (straflosen) Selbstgefährdung geht (während dieselben Gerichte etwa wegen durchaus gravierenden Fällen von Körperverletzung nicht selten Geldstrafen oder zur Bewährung ausgesetzte Strafen von unter zwei Jahren verhängen).“ (vgl. Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zum Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG), BT−Drucks. 18/4204). |
cc) Cannabis und Abhängigkeit
Gerade bei denjenigen Konsumenten, die unter einem Abhängigkeitssyndrom leiden, steht die staatliche Reaktion mit Kriminalstrafe in einem krassen Wertungswiderspruch zu dem eigentlichen Bedarf an therapeutischer Behandlung. Einen kranken Menschen mit Bestrafung noch weiter in seelische und persönliche Nöte zu treiben, stellt einen Verstoß gegen das rechtstaatliche Übermaßverbot dar, vielmehr müsste die staatliche Politik in einem solchen Fall dafür Sorge tragen, dass er von dieser Krankheit geheilt oder ihm zumindest Linderung verschafft wird (vgl. hier Vorlagebeschluss des Landgerichts Lübeck, 1992, S. 30 f.).
dd) Cannabis als Medizin
Offenkundig unverhältnismäßig ist die strafrechtliche Sanktionierung des Besitzes und Konsums von Cannabis überdies in Fällen, in denen Cannabis – ohne ärztliche Verschreibung – zu medizinischen Zwecken konsumiert wird. In diesem Zusammenhang ist in die Abwägung mit einzustellen, dass der Konsum von Cannabis durchaus auch Teil des absoluten geschützten Kernbereichs der allgemeinen Handlungsfreiheit sein kann. Dies gilt insbesondere für solch einen Umgang mit Cannabis, der der Steigerung des Appetits etwa bei Menschen mit Essstörungen, beispielsweise bei Krebs- oder Autoimmunerkrankungen, der Minderung von Schmerzen, der Ermöglichung des Schlafs, der einfachen Erholung, der Entspannung, der Vertiefung von Wahrnehmungen und Empfindungen und noch deutlicher dort, wo er dem Zweck der Selbstbehandlung vermeintlicher oder tatsächlicher, gar ärztlich festgestellter, behandlungsbedürftiger Erkrankungen dient. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus 1994 die Geltendmachung eines in den Kernbereich des Persönlichkeitsrechts zu verortenden „Rechts auf Rausch“, gestützt auf Art. 2 Abs. 1 GG, abgelehnt und ausgeführt hat, dass „der Umgang mit Drogen, insbesondere auch das Sich-Berauschen, aufgrund seiner vielfältigen sozialen Aus- und Wechselwirkungen nicht“ zum Kernbereich privater Lebensgestaltung gerechnet werden kann, ist bei der Abwägung im Rahmen des Übermaßverbots dennoch miteinzubeziehen, dass in vielfältigen Fallkonstellationen der Konsum von Cannabis in seiner konkreten Funktion für den Einzelnen dem Kernbereich privater Lebensgestaltung unterfallen kann (vgl. hierzu auch Möller S. 98).
ee) Kriminalisierung von Millionen
Schließlich spricht schon allein die Anzahl von ca. vier Millionen Konsumenten in Deutschland, die damit einhergehende massenhafte Kriminalisierung sowie die durch die Strafverfolgung entstehenden immensen Kosten für Staat und Gesellschaft für die Unverhältnismäßigkeit der strafrechtlichen Sanktionen. Für die Kriminalisierung eines Verhaltens, welches durch einen nicht unwesentlichen Teil der Bevölkerung offensichtlich als legitim akzeptiert ist, bedarf es jedenfalls gewichtiger und tragfähiger Gründe. Solche Gründe lassen sich aber – wie nunmehr ausführlich dargelegt – im Fall des mit Kriminalstrafe bewehrten Verbots von Cannabis nicht (mehr) finden.
ff) Opfer der Prohibition
Im Rahmen der Prüfung, ob vorliegend und mittlerweile das Übermaßverbot durch den Gesetzgeber verletzt wird, bedarf es auch immer einer Prüfung der durch die Gesetzgebung ausgehenden Beeinträchtigung der Grundrechte des oder der betroffenen Bürger (vgl. BVerfGE 90, 145, 185). Der Gesetzgeber hatte mit der Cannabisprohibition beabsichtigt die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren und insbesondere junge Menschen vor den Eintritt in die Suchtmittelabhängigkeit zu bewahren. Diese ursprünglich legitimen Zielsetzungen sind heute aufgrund der bereits beschriebenen Umstände nicht mehr zu rechtfertigen. Dies insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlich durch den Cannabiskonsum betroffenen Personen, die eine stationäre Therapie infolge des Konsums von Cannabis absolvieren müssen, nämlich wie oben dargelegt einer jährlichen Zahl von um die 3.500 Personen, die im Übrigen auch über die Jahre konstant geblieben ist (vgl. oben S. 21).
Dagegen muss aber gesehen werden, dass die Cannabisprohibition in den vergangenen 50 Jahren insgesamt Millionen von Opfern schaffen hat. Da wären zunächst all die Menschen die sich vor Straf- oder Jugendrichtern verantworten mussten. Da sind die Menschen die infolge der Prohibition über Jahrzehnte Cannabis nicht als Medizin bekommen haben und es sind weiter nach Berechnungen und unter Berücksichtigung der Statistiken der vergangenen Jahre, all die Menschen die wegen des Umgangs mit Cannabis, in welcher Form auch immer, zur Freiheits- oder Jugendstrafen verurteilt und auch inhaftiert wurden. Schließlich auch diejenigen die ihre Geldstrafen nicht bezahlen konnten und stattdessen Ersatzfreiheitsstrafen verbüßten mussten. Abgesehen von den Personen, die persönlich sanktioniert waren, wurde auch regelmäßig ihr Familienumfeld betroffen. Hier sind ganze Familien infolge des Umgangs mit Cannabis zerstört worden. Führerscheine wurden entzogen und viele, viele Menschen haben ihre Arbeitsmöglichkeit verloren. Wenn man diese Zahlen zusammenrechnet, hat der Staat in Form einer vielleicht ehemals vernünftigen Cannabispolitik aber seit Jahrzehnten nicht mehr haltbaren Cannabispolitik, Millionen von Opfern geschaffen. Und dies im Verhältnis zu wenigen, die er vielleicht geschützt hat.
gg) Zusammenfassung.
Die Frage, ob ein Eingriff in ein Grundrecht das Übermaßverbot verletzt, ist mit Hilfe einer Abwägung zu beantworten. Dabei sind einerseits die Wertigkeit des Rechtsgutes, um dessen Schutz aus dem Gesetzgeber geht (hier Schutz der Volksgesundheit, der Familie, der Jugend), das Ausmaß des diesem Rechtsgut drohenden Schadens, der Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sowie etwa bestehender Zeit – und Problemdruck für den Gesetzgeber in Rechnung zu stellen. Andererseits müssen die Schwere des Eingriffs, seine Breite sowie Nähe des inkriminierenden Verhaltens zu dem Schaden bedacht werden. Letzteres spielt insbesondere bei Strafandrohungen, die abstraktes – gefährliches Verhalten sanktionieren eine erhebliche Rolle. Die Gefährdung des geschützten Rechtsguts kann ein so geringes Maß erreichen, dass die generalpräventiven Gesichtspunkte, die eine generelle Androhung der Strafe rechtfertigen, an Gewicht verlieren. Dies umso mehr, wenn einerseits nur wenige geschützt werden und andererseits, wie vorliegend, Millionen von Menschen in ihren Freiheitsrechten enorm betroffen sind. Führt eine Abwägung dazu, dass die individuelle Schuld des Täters und der sich hieraus ergebenen spezial-präventiven kriminalpolitischen Ziele einer übermäßigen und deswegen verfassungswidrigen Sanktion darstellt ist das Übermaßverbot nicht mehr eingehalten. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in seinem Beschluss vom 09.03.1994 festgestellt, dass eine Abwägung zwischen der Intensität des Eingriffs und dem Grundrecht des Einzelnen auf Freientfaltung seiner Persönlichkeit dazu führen kann, dass es nur noch die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetz zu folgen haben kann. Aufgrund aller bereits oben aufgeführten Umstände kommt das Amtsgericht Bernau bei Berlin zu der festen Überzeugung, dass durch das Beibehalten der Cannabisprohibition heute in Kenntnis aller jahrelangen Erfahrungen, jedenfalls gegen das Übermaßverbot und damit weiter gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip im engeren Sinne durchgehend verstoßen wird.
e) Beurteilungsspielraum
Schließlich ist vorliegend eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch im Hinblick auf den dem Gesetzgeber im Hinblick auf Zweck und Umsetzung von Gesetzen grundsätzlich zustehenden weiten Beurteilungsspielraum (vgl. BVerfGE 90, 145 (183) m. w. N.) geboten.
So sind – auch unter Berücksichtigung des weiten Beurteilungsspielraums – unter besonderen Voraussetzungen Konstellationen denkbar, in denen gesicherte kriminologische Erkenntnisse im Rahmen der Normenkontrolle insoweit Beachtung erfordern, als sie geeignet sind, den Gesetzgeber zu einer bestimmten Behandlung einer von Verfassungswegen gesetzlich zu regelnden Frage zu zwingen oder doch die getroffene Regelung als mögliche Lösung auszuschließen (vgl. BVerfGE 50, 205, 212 f.).
So aber liegt der Fall hier.
Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner Entscheidung von 1994 noch festgestellt, dass die Einwendung, die bisherige Cannabisprohibition habe die Gesetzesziele nicht vollständig erreichen können, nicht durchdringen könne und dass internationale Abkommen bei der Bekämpfung von Drogen zunehmend auf den Einsatz strafrechtlicher Mittel setzten und daher die durch den Gesetzgeber gewählte Gesamtkonzeption im Rahmen seines Beurteilungsspielraums nicht zu beanstanden sei. Nun aber drängen die dargelegten neuen Erkenntnisse zu der Annahme, dass die Cannabisprohibition zur Erreichung der durch den Gesetzgeber erklärten Ziele ungeeignet, jedenfalls nicht erforderlich und zumindest unverhältnismäßig ist. Die neueren internationalen Entwicklungen, die den Umgang mit Cannabis entkriminalisieren und regulieren, die neue Standortbestimmung von WHO und die Kritik der Weltkommission für Drogenpolitik reduzieren den gesetzgeberischen Beurteilungsspielraum. Hier aber wird er durch den Gesetzgeber nicht genutzt. Der Beurteilungsspielraum stellt keine Rechtfertigung dafür dar, neuere Erkenntnisse und verfassungsrechtliche Vorgaben unbeachtet zu lassen. Der Gesetzgeber hat vielmehr eine Pflicht, das Strafrecht nur dann einzusetzen, wenn dies unablässig ist. Reagiert der Gesetzgeber nicht, muss ihn das Bundesverfassungsgericht dazu anhalten, wo die Prohibition Grundrechte verletzt.
2. Verstoß gegen Art.2 Abs.1 GG i.v. mit dem Recht auf Rausch
Das Bundeverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1994 auf die Vorlage des Landgerichts Lübeck ein Recht auf Rausch verneint. Es hat seinerzeit ohne sich genau mit diesem Recht auf Rausch, dass mittlerweile viele, viele Menschen in der Gesellschaft als Teil ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit und auch ihres allgemeinen Persönlichkeitsrecht ansehen, nicht auseinandergesetzt. Das Amtsgericht Bernau bei Berlin, wie auch zuvor das Landgericht Lübeck im Jahre 1992 vertritt im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 1994 und unter Berücksichtigung auch des Wertewandels in der Gesellschaft heute das Bestehen eines Rechts auf Rausch. Denn das Berauschen , insbesondere mit der milden Droge Cannabis, betrifft derart den Kernbereich privater Lebensführung, dass dieses individuelle Recht mittels eines Prohibitionsgesetzes nicht eingeschränkt werden darf. Das Betäubungsmittelgesetz stellt sich als formelles Gesetz als Teil der verfassungsmäßigen Ordnung da. Sofern aber ein Recht auf Rausch als Kernbereich der privaten Lebensführung angesehen würde, unabhängig davon, ob dies auch bei Alkohol- und Nikotinkonsum der Fall ist, so darf aufgrund eines Gesetzes gar nicht in diese Art der freien Entfaltung der Persönlichkeit eingegriffen werden. Sofern ein Recht auf Rausch bejaht würde, wären zu mindestens die Handlungsalternativen des § 29 BtMG, nämlich des sich Verschaffens, des Besitzes und des Erwerbens - wie vorliegend - zum Kernbereich privater Lebensführung zu zählen. Soweit diese Handlungsalternativen in einem sozialen Kontakt stehen und diese notwendig sind, um das „Recht auf Rausch“ welches Teil der Privatsphäre ist, zu verwirklichen oder zu ermöglichen müssen diese Handlungen straflos gestellt werden. (vgl. Möller S. 99 sowie Siebel Drogenstrafrecht in Deutschland und Frankreich, 1997, S. 204). Insoweit soll auch auf das Urteil des 2. Senats vom 26.02.2020 zur Sterbehilfe verwiesen werden (vgl. 2 BVR 2347/15). Hier stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Abs. 1 GG i.V.m. Artikel 1 Abs. 1 GG auch den Ausdruck persönlicher Autonomie umfasse und hieraus ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben abzuleiten sei. Im 1.Leitsatz heißt es weiter:
| „Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seines Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren Die Freiheit sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierbei bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen“ |
Sofern man die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vorliegend auf die Frage, ob es auch ein Recht auf Rausch gibt, in Bezug setzt, so muss man bei einer stringenten und vergleichenden weiteren Auslegung auch dazu kommen, dass es eben auch ein Recht auf selbstbestimmtes Berauschen gibt. Denn das Berauschen ist im Verhältnis zum Selbstmord nur vorübergehender Natur und insoweit sogar weniger sprich ein Minus und kann auch für das Leben in vielen Fällen sogar Vorteile haben. Während der Mensch, der sich das Leben nehmen möchte, nunmehr berechtigt sein soll für seinen Suizid Hilfe in Anspruch zu nehmen, gilt dies für denjenigen, der sich nur vorübergehend aus dem normalen Leben entfernen möchte, nicht bzw. nur mit Alkohol. Um es deutlich zu machen. Ein Mensch, der seinen eigenen Tod vorbereitet bleibt grundsätzlich straflos und wird auch nicht bestraft, sofern sein Suizid erfolglos bleibt. Er darf nach festen Regeln sich auch der Hilfe anderer bedienen. Hat er sich allerdings für die Tage davor und um den Suizid leichter durchführen zu können Cannabis oder auch eine andere Rauschdroge besorgt, wird er bei gegenwärtiger Rechtslage für das Besorgen der illegalen Droge bestraft.
Das Amtsgericht Bernau bei Berlin kommt unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum bereits zitierten Sterbehilfe Urteil zu der Überzeugung, dass auch das Berauschen als im Verhältnis wesentlich geringeres schädigendes menschliches Verhalten zum Kernbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes gehört und in allen Kulturkreisen dieser Welt auf die ein oder andere Art gepflegt wird. In Deutschland allerdings nur mit dem Betäubungsmittel Alkohol. Und um dieses Recht auch bezüglich anderer Drogen ausleben zu können gehören insbesondere auch Vorbereitungshandlungen, wie Besitz, Erwerbens oder sich Verschaffen von Cannabis zwangsläufig dazu.
Nach alledem kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass durch die bestehende Cannabiskriminalisierung auch das Recht auf Rausch jedenfalls bei Erwachsenen verletzt ist.
3. Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG
Soweit das hier gegenständliche Strafgesetz für das Gericht die Möglichkeit der Verhängung von Freiheitsstrafen vorsieht, verstößt es weiterhin gegen Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG, wonach die Freiheit der Person unverletzlich ist. In dieses durch das Grundgesetz als besonders hohes Rechtsgut ausgeprägte Grundrecht darf nur aufgrund des Gesetzesvorbehalts des Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG eingegriffen werden.
Die Freiheitsbeeinträchtigung, sofern sie nicht konkret erfolgt, droht jedenfalls im vorliegenden Fall bereits, wenn eine polizeiliche Vorführung vor den Haftrichter erfolgen kann; sie droht, weil das Strafgericht in die Lage versetzt wird, die Angeklagte zu einer Hauptverhandlung zu laden und für den Fall des Nichterscheinens Vorführung oder gar Haftbefehl gemäß § 230 StPO erlassen kann; sie droht, wie im vorliegenden Fall, aufgrund der Vollstreckungshaftbefehle wegen nicht gezahlter Geldstrafen ersichtlich, auch in Fällen, in denen eine Ersatzfreiheitsstrafe nicht durch eine sofortige Zahlung abgewendet werden kann.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind freiheitsentziehende Maßnahmen nur zulässig, wenn der Schutz anderer oder der Allgemeinheit dies unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordert (vgl. BVerfGE 58, 208 (224 ff.); 59, 275 (278)). Wie oben bereits ausgeführt, sind die hier angegriffenen Strafvorschriften angesichts des Standes der Wissenschaft sowie der neuen kriminologischen und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht mehr verhältnismäßig. Wenn sich dies bereits im Hinblick auf die Prüfung einer Verfassungswidrigkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG ergibt, dann muss dies erst recht im Bereich der Einschränkung des Rechts auf Freiheit der Person gelten.
Insbesondere sind die Gefahren für den durchschnittlichen Konsumenten, Dritte und die Allgemeinheit, wie oben ausgeführt, derart gering und das strafbewehrte Verbot zur Durchsetzung der gesetzlichen Zielsetzung derart ungeeignet, dass sie die Verhängung von freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht rechtfertigen und insoweit nicht verhältnismäßig sind. Hinsichtlich der einzelnen Aspekte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gilt das oben bei der Prüfung von Art. 2 Abs.1 GG dargelegte.
4. Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG
Die Strafbarkeit gemäß §§ 29 Abs. 1 BtMG hängt in allen Handlungsalternativen davon ab, ob die Handlungen sich auf Stoffe und Zubereitungen beziehen, die in den Anlagen I bis III zu § 1 Abs. 1 BtMG aufgeführt sind. In diesen Anlagen I bis III ist Alkohol nicht aufgeführt.
Hingegen sind in der Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG Cannabis, Marihuana, d. h. die Blütenstände der Cannabispflanze aufgeführt. Das vorlegende Amtsgericht kommt zu der Überzeugung, dass das Aufführen der Cannabisprodukte und das Nichtaufführen von Alkohol in den Anlagen I bis III zu § 1 Abs. 1 BtMG gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG verstößt.
Nach einhelliger Meinung in der verfassungsrechtlichen Literatur und Rechtsprechung (vgl. Mangold/Klein/Starck, Grundgesetz Kommentar 7. Aufl. 2018, Art. 3 Rn. 10 f., 40 ff. m. w. N.) stellt Art. 3 Abs. 1 GG ein den Gesetzgeber bindendes Willkürverbot dar. Er verbietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches willkürlich ungleich und wesentlich Ungleiches willkürlich gleich zu behandeln. Diese von Art. 3 Abs. 1 GG geforderte Rechtsgleichheit verlangt allerdings nur verhältnismäßige Gleichheit. Der Gleichheitssatz ist erst dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonst sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt, wenn also die Bestimmung als willkürlich bezeichnet werden muss (BVerfGE 1, 52; 3, 135; 9, 349; 13, 227/228; 42, 73; 59,97), wobei dem Gesetzgeber bei der Regelung der einzelnen Sachverhalte eine weitgehende Gestaltungsfreiheit und ein weiter Ermessensspielraum zusteht. Dieser endet erst dort, wo die Gleich- oder Ungleichbehandlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Gleichbehandlung oder Differenzierung fehlt (BVerfGE 59, 97; 3, 136). Nach Auffassung des Amtsgerichts gibt es keinen einleuchtenden Grund dafür, Cannabisprodukte in der Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG aufzuführen und das Produkt Alkohol nicht in die Anlage zu § 1 Abs. 1 BtMG aufzunehmen. Dabei verlangt das Gericht nicht, dass auch Alkohol in die Anlage zu § 1 Abs. 1 BtMG aufgenommen werden soll, sondern nur dass Cannabis und seine verschiedenen Zubereitungen aus der Anlage entfernt werden und damit eine Strafbarkeit bezüglich des Umgangs mit Cannabis entfällt.
Im Ergebnis der Beweisaufnahme ist das Gericht der Überzeugung, dass das Aufführen von Cannabisprodukten in dieser Liste und das Nichtaufführen von Alkohol gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt. Alkohol und Nikotin sind sowohl für den Einzelnen als auch gesamtgesellschaftlich evident gefährlicher als Cannabisprodukte. Bei dieser vergleichenden Betrachtung wird unterstellt, dass die Gefahren des illegalen Marktes, etwa der Handel im dunklen Park, nicht zum Vergleich herangezogen werden kann, weil er prohibitionsbedingt ist. Entsprechendes gilt für das Fehlen von Inhaltsangaben, Gefahrenhinweisen, Jugendschutz, Verunreinigungen beim Erwerb von Cannabisprodukten, weil sie vornehmlich durch das Verbot jedweden Umgangs mit Cannabis entstehen; ein regulierter Markt würde diese Gefahren, dazu wurde bereits ausgeführt, fast vollständig beseitigen. Gegenstand der vergleichenden Betrachtung kann also allein die Wirkung des Cannabis gegenüber der Wirkung des Alkohols sein, auf den sich aus Gründen der Vereinfachung die nachfolgenden Ausführungen zum Vergleich beziehen.
a) Ungleichbehandlung
aa) Bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Die Risiken des Alkoholkonsums, insbesondere des Alkoholmissbrauchs, waren auch dem Bundesverfassungsgericht 1994 bekannt. Dagegen waren die Risiken des Cannabiskonsums nicht in dem zuvor beschriebenen Umfang bekannt. Das Bundesverfassungsgericht hielt auf der Grundlage der teilweisen Unkenntnis den Gleichheitsgrundsatz für nicht verletzt.
Das Bundesverfassungsgericht führte in seiner Entscheidung 1994 aus, dass die unterschiedliche Behandlung von Cannabisprodukten und Alkohol gerechtfertigt seien, weil sich der Konsum von Alkohol dadurch von dem Konsum von Cannabis unterscheide, da der Alkohol in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten genutzt und konsumiert werde (BVerfGE 90, 145 (197)).
Alkoholhaltige Substanzen könnten als Lebensund Genussmittel eingesetzt werden, in Form von Wein würden sie auch im religiösen Bereich verwandt. Insbesondere sei der Konsum von Alkohol nicht (allein) rauschorientiert; so dominiere eine Verwendung des Alkohols dahingehend, dass dieser nicht zu Rauschzuständen verwandt würde. Dagegen ging das Bundesverfassungsgericht 1994 davon aus, dass beim Konsum von Cannabisprodukten die Erzielung einer berauschenden Wirkung typischerweise im Vordergrund stehe (BVerfGE 90, 145 (186)). Schließlich sei die unterschiedliche Behandlung von Alkohol und Cannabis deswegen gerechtfertigt, weil es sich letztlich, so sinngemäß, bei Alkohol um eine europäische Kulturdroge handle, die sich insoweit von dem Rauschmittel Cannabis unterscheide. Auch ging das Bundesverfassungsgericht unter Berücksichtigung des damaligen Erkenntnisstandes noch davon aus, dass es sich bei den von ihm im Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes verglichenen Cannabissubstanzen und Alkohol um „potenziell gleich schädliche Drogen“ handele. Dieser Standpunkt ist im Hinblick auf die neuen Erkenntnisse im Hinblick auf die Auswirkungen des Konsums von Cannabis nicht mehr vertretbar. Während die Gesundheitsgefahren, welche mit dem Konsum von Alkohol einhergehen, erheblich sind , ist der Konsum von Cannabis auch und insbesondere im Vergleich zu Alkohol als relativ ungefährlich zu betrachten.
bb) Gefahren des Alkoholkonsums
Alkohol ist eine psychoaktive Substanz, die Abhängigkeit erzeugen kann.
Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum zählt zu den fünf wesentlichen Risikofaktoren für Krankheiten, Beeinträchtigungen und Todesfälle weltweit. Er wird als mitverursachend für mehr als 200 Krankheiten angesehen und ist für die Entstehung vieler beabsichtigter und unbeabsichtigter Verletzungen mit verantwortlich (vgl. Lange, Cornelia/Manz, Kristin/Rommel, Alexander/ Schienkiewitz, Anja/Mensink, Gert B. M., Alkoholkonsum von Erwachsenen in Deutschland: Riskante Trinkmengen, Folgen und Maßnahmen, Robert KochInstitut Berlin, Journal of Health Monitoring 2016, S. 1 ff. – im Folgenden zitiert als ‚Robert Koch-Institut 2016‘).
Das Zellgift erhöht das Risiko für Leiden im Magen und Darm, für Leberzirrhose, Herzerkrankungen. Auch sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Demenz und mehrere Krebsarten erhöht (vgl. WHO 2014, [folgt eine URL]).
Als riskanter Alkoholkonsum wird ein täglicher Reinalkoholkonsum von mehr als 10 Gramm bei Frauen und mehr als 20 Gramm bei Männern angesehen. Für die Jahre 2008 bis 2011 wird mittels der „Studie zur Gesundheit Erwachsener“ (Robert Koch-Institut, DEGS: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, im Folgenden zitiert als DEGS 1) der riskante Alkoholkonsum für die Altersgruppen 18 bis 79 Jahre berechnet und der Zusammenhang mit soziodemografischen und gesundheitsbezogenen Faktoren untersucht.
Die Ergebnisse von DEGS 1 zeigen, dass 13,1 Prozent der Frauen und 18,5 Prozent der Männer in riskanten Mengen Alkohol konsumieren. Bei Männern steigt der riskante Alkoholkonsum mit dem Alter an; bei Frauen findet sich die niedrigste Prävalenz bei 30- bis 39-Jährigen und die höchste bei 50- bis 59-Jährigen. Frauen mit einem hohen sozioökonomischen Status trinken zu höheren Anteilen in riskantem Maß Alkohol als Frauen aus mittleren oder niedrigen Statusgruppen. Bei Männern zeigen sich keine entsprechenden Unterschiede. Vor allem Rauchen steht mit riskantem Alkoholkonsum in Zusammenhang.
Zwischen 1990 und 1992 sowie 2008 und 2011 hat der riskante Alkoholkonsum stark abgenommen, bei Frauen von 50,9 Prozent auf 13,6 Prozent, bei Männern von 52,6 Prozent auf 18,3 Prozent (Altersgruppe 25 bis 69 Jahre).
Auch wenn der riskante Alkoholkonsum in der Bevölkerung stark zurückgegangen ist, liegt der Pro-Kopf-Konsum von Reinalkohol in Deutschland über dem Durchschnitt der EUMitgliedsstaaten (vgl. Robert Koch-Institut 2016).
Das Statistische Bundesamt hat gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) eine Liste von 17 Krankheiten zusammengestellt, die zu 100 Prozent als alkoholbedingt anzusehen sind. Dazu gehören:
| - | ICD-10 E24.4 Alkoholinduziertes Pseudo-Cushing-Syndrom, |
| - | ICD-10 E52 Niazinmangel (alkoholbedingte Pellagra); |
| - | ICD-10 F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, |
| - | ICD-10 G31.2 Degeneration des Nervensystems durch Alkohol, |
| - | ICD-10 G62.1 AlkoholPolyneuropathie, |
| - | ICD-10 G72.1 Alkoholmyopathie, |
| - | ICD-10 I42.6 Alkoholische Kardiomyopathie, |
| - | ICD-10 K29.2 Alkoholgastritis, |
| - | ICD-10 K70 Alkoholische Leberkrankheit, |
| - | ICD-10 K85.2 Alkoholinduzierte akute Pankreatitis (ab 2006), |
| - | ICD-10 K86.0 Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis, |
| - | ICD-10 O35.4 Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol, |
| - | ICD-10 P04.3 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch
Alkoholkonsum der Mutter, |
| - | ICD-10 Q86.0 Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien) |
(vgl. Robert Koch Institut Alkohol 2016).
Im Jahr 2014 wurde in Deutschland bei 14.099 Verstorbenen eine ausschließlich alkoholbedingte Erkrankung als Todesursache festgestellt. Schätzungen aus der „Global Burden of Disease Studie“ zeigen zudem, dass weltweit 5 Prozent aller durch Tod oder Beeinträchtigung verlorenen Lebensjahre (DALYs) auf Alkohol zurückgeführt werden können. In Deutschland steht bezogen auf das Jahr 2013 Alkoholkonsum unter allen Risikofaktoren bei Männern an fünfter Stelle, bei Frauen an achter Stelle.
1,8 Millionen Deutsche gelten als alkoholabhängig. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Neben der Zahl von etwa 14.000 Alkoholtoten im Jahr 2014 sterben jährlich etwa weitere 60.000 Menschen (vgl. Stockrahm, Sven, Bloß nicht mehr als ein Bier pro Tag!, Zeit Online vom 13.04.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Untersuchungen zu alkoholbezogenen Gesundheitsstörungen und Todesfällen gehen danach von etwa 74.000 Todesfällen aus, die allein durch den Alkoholkonsum oder den kombinierten Konsum von Tabak und Alkohol verursacht sind. Die wenigen Berechnungen alkoholbedingter Todesfälle in Deutschland weisen eine hohe Wahrscheinlichkeit der Unterschätzung auf, denn meist fließen in die Berechnung der Todesfälle, die allein auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind, nur die Diagnosen ein, die zu 100 Prozent auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Dies sind die Todesursachen Alkoholabhängigkeitssyndrom und Leberzirrhose (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Alkohol, abrufbar unter http://www.dhs.de/datenfakten/alkohol.html – im Folgenden zitiert als: DHS Alkohol; John, U./Hanke, M., Alcohol-attributable mortality in a high per capita consumption country – Germany, Alcohol and Alcoholism 2002, S. 581-585).
Eine psychische oder verhaltensbezogene Störung durch Alkohol wurde im Jahr 2016 als zweithäufigste Hauptdiagnose in Krankenhäusern mit 322.608 Behandlungsfällen diagnostiziert, davon waren 234.785 Behandlungsfälle männliche Patienten und 87.820 Frauen.
22.309 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zehn und 20 Jahren wurden 2016 aufgrund eines akuten Alkoholmissbrauchs stationär behandelt, das waren 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2000 waren es rund 9.500 Behandlungsfälle in diesen Altersgruppen. Dies bedeutet eine Steigerung von 134,5 Prozent auf das Jahr 2016 (Statistisches Bundesamt, Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern (einschl. Sterbe- und Stundenfälle) 2016).
Hinsichtlich der Auswirkungen des Alkoholkonsums unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) neben den gesundheitlichen Folgen für die Konsumenten auch zwischen sozioökonomischen Folgen für die Betroffenen sowie den Schäden für andere Personen und für die Gesellschaft insgesamt.
Die Schäden für das Individuum bestehen in chronischen Gewebe-und Organschädigungen aufgrund der toxischen Wirkung von Alkohol (schädlicher Gebrauch oder Missbrauch, ICD10: F10.1), akuter Alkoholintoxikation, die sich in Beeinträchtigungen der Koordination, des Bewusstseins, der Wahrnehmung und des Auffassungsvermögens äußern kann (ICD-10: F10.0), sowie der Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit (Abhängigkeitssyndrom ICD-10: F10.2).
Die individuellen sozioökonomischen Folgen eines riskanten, missbräuchlichen oder abhängigen Alkoholkonsums können von Stigmatisierung, sozialem Rückzug, familiären Problemen bis zum Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung und vollständiger sozialer Ausgrenzung reichen.
Schädigungen Dritter erfolgen vor allem durch körperliche Verletzungen infolge von Gewalt oder Unfällen, durch psychische Verletzungen und Belastungen von Partnerinnen bzw. Partnern, Familie, Freunden, Kolleginnen bzw. Kollegen sowie Schädigungen von Kindern im Mutterleib (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD).
Zu den gesellschaftlichen Folgen des Alkoholkonsums zählen, neben den direkten Kosten für das Gesundheitssystem, Produktivitätsverluste wie Fehlzeiten am Arbeitsplatz oder Frühberentungen sowie immaterielle Kosten zum Beispiel durch den Verlust von Lebensqualität. Diese volkswirtschaftlichen Kosten des Alkoholkonsums in Deutschland werden je nach Schätzungen auf einen Betrag von bis zu 40 Milliarden Euro im Jahr taxiert, davon entfällt rund ein Viertel auf direkte Kosten für das Gesundheitssystem (vgl. Robert Koch-Institut 2016 m. w. N.).
Unfälle unter Alkoholeinfluss haben im Vergleich zum gesamten Unfallgeschehen im Straßenverkehr oftmals besonders schwere Folgen. Im Jahr 2014 wurden in Deutschland 260 Menschen bei alkoholbedingten Unfällen getötet. 13.742 alkoholisierte Unfallbeteiligte wurden von der Polizei festgestellt. 40 Prozent waren junge Männer zwischen 18 und 34 Jahren (Robert Koch-Institut 2016).
Die Wirkung von Alkohol auf das zentrale Nervensystem wird wie folgt beschrieben: In niedrigen Dosierungen, bei einer Blutalkoholkonzentration von etwa 0,5 Promille, enthemmt Alkohol vor allem. Euphorie und Redseligkeit, das Verschwinden von Ängsten und Selbstüberschätzung werden beschrieben. Auch das berühmte „Doppeltsehen“ kann schon bei geringen Alkoholdosen auftreten. Weiter werden Atmung und Puls schneller, die Blutgefäße erweitern sich, die Sinneswahrnehmungen verschlechtern sich leicht, das Schmerzempfinden nimmt ab. Bei höheren Dosierungen, etwa bei einem Richtwert von 1 bis 2 Promille, stört Alkohol die Selbstkontrolle und die Koordination und beeinträchtigt die Bewegungsfähigkeit.
Die Stimmung kann sich verändern, einige Menschen werden typischerweise aggressiv. Bei einem Blutalkoholgehalt von 0,5 bis 1,5 Promille wird die Herabsetzung der Hemmschwelle beschrieben, Gedächtnisleistungen verschlechtern sich. Ab etwa 2 Promille ist bei vielen Menschen auch das Bewusstsein gestört und der Betrunkene wird zunehmend müde. Der Zustand wird üblicherweise als Vollrausch beschrieben und geht oft mit Übelkeit und Erbrechen einher. Bei etwa 3 bis 4 Promille ist ein klares Denken kaum mehr möglich, bei über 4 Promille verlangsamen sich Atmung und Puls so stark, dass dies Koma oder Tod zur Folge haben kann. Bewusstlosigkeit und der Zusammenbruch des Kreislaufs, Aussetzen von Atmung sind ursächlich (vgl. [folgt eine URL] und [folgt eine URL]).
cc) Ungleichbehandlung: Alkohol – Cannabis
Gegenüber den aufgeführten erheblichen Gefahren des Alkoholkonsums wurde die – relative – Ungefährlichkeit von Cannabis bereits oben ausführlich dargestellt. Auf die Ausführungen wird, zur Vermeidung von Wiederholungen, an dieser Stelle umfassend verwiesen.
Insofern sei an dieser Stelle lediglich nochmals auf zwei wesentliche Vergleichsstudien hingewiesen, deren Tabellen einen kurzen Eindruck über die vorstehend ausgeführten Umstände belegen.
Das britische Independent Scientific Committee on Drugs (vgl. [folgt eine URL]) stellte die zuvor unter D. I. 1. d. bereits dargestellten Vergleichsergebnisse vor:
| Droge | Schädigungsgrad |
| Alkohol | 72 |
| Heroin | 55 |
| Crack-Kokain | 54 |
| Metamphetamine | 33 |
| Kokain | 27 |
| Tabak | 26 |
| Amphetamine | 23 |
| Cannabis | 20 |
Auch der Roques-Report (vgl. Roques B. Problemes posées par la dangerosité des drogues. Rapport du professeur Bernhard Roques au Secrétaire d'Etat à la Santé. Paris, 1998, vgl. auch Alkohol – Opium fürs Volk, Die Zeit vom 02.07.1998, abrufbar unter [folgt eine URL]) kommt zu dem eindeutigen Schluss, dass starker Cannabiskonsum wesentlich geringere Schäden verursacht als sonstiger starker Konsum gebräuchlicher Drogen:
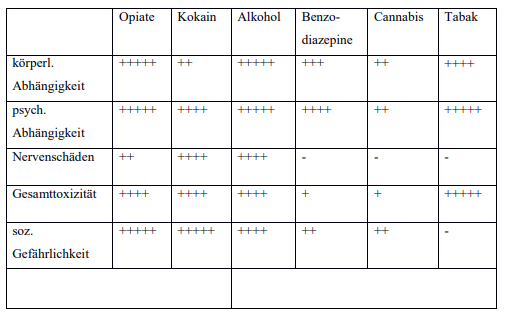
* = keine Effekte,
+ = sehr schwache Effekte,
++ = schwache Effekte,
+++ = mittelstarke Effekte,
++++ = starke Effekte,
+++++ = sehr starke Effekte
(vgl. [folgt eine URL]; zu weiteren Vergleichen der Gefahren durch den Alkoholkonsums verglichen mit denen des Cannabiskonsums siehe: [folgt eine URL] m.w.N.; [folgt eine URL] m.w.N.; Structural neuroimaging correlates of alcohol and cannabis use in adolescents and adults, erschienen im Fachmagazin Addiction vom 23.06.2017, [folgt eine URL]).
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass dem Gericht in seiner 25jährigen Praxis zwar eine Vielzahl durch Alkoholkonsum angefeuerte Rohheitsdelikte bekannt sind, hingegen – außerhalb des Straßenverkehrs – kein einziger Fall der cannabisinduzierten rauschbedingten Straftat bekannt geworden ist. Straftaten unter Alkoholeinfluss, der die Gewaltbereitschaft, die Risikobereitschaft und vor allem die Fähigkeit zur Selbstkritik einschränkt, sind hinlänglich bekannt (vgl. zur unterschiedlichen Behandlung von Cannabis und Alkohol/Nikotin auch Möller, S.120 ff.).
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass zumindest im Straßenverkehrsrecht, insbesondere im Bereich der §§ 315 c StGB wie auch im Rahmen des § 316 StGB die akute Beeinflussung durch das Betäubungsmittel Cannabis einerseits und Betäubungsmittel Alkohol andererseits zwar rechtlich gleichbehandelt werden. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass bei einem (legalen) Blutalkoholwert von 0,5 Promille das Unfallrisiko um nahezu 100 Prozent im Vergleich zu 0,0 Promille steigt, während für den Grenzwert von 1 ng/ml beim CannabisKonsum keine Wirkung auf ein Unfallrisiko feststellbar ist. Bei Fahrern unter Cannabiseinfluss kommt es zudem seltener zu von ihnen verursachten Unfällen und das Trennungsvermögen ist beim Cannabis-Konsum ebenfalls wesentlich besser als beim Alkoholkonsum (vgl. Hanfjournal vom 03.01.2015, Die letzten Bastionen der Gegner wackeln, abrufbar unter [folgt eine URL] – siehe auch: [folgt eine URL]).
Unter Berücksichtigung der neueren, dem Bundesverfassungsgericht von 1994 nicht bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse kann somit heute nicht mehr davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Betäubungsmitteln Alkohol und Cannabis um potenziell gleich schädliche Drogen handelt. Bei Beachtung der wissenschaftlich haltbaren Risiken hinsichtlich des Cannabiskonsums (siehe oben) und den als offenkundig zu betrachteten Risiken beim Alkoholmissbrauch kann die These der „potenziell gleich schädlichen Drogen“ nicht mehr gehalten werden.
dd) Sachlicher Grund
Sachlich gebotene, rechtfertigende Gründe für die aufgezeigte unterschiedliche Behandlung gibt es nicht.
Cannabis kann – wie Alkohol – in verschiedensten Dosierungen und Darreichungsformen (Rauchen, Pfeife, Tee, Gebäck usw.) konsumiert werden. Cannabis kann – wie Alkohol – zu medizinischen Zwecken (zu den Anwendungen des Cannabis vgl. [folgt eine URL]l) und auch zu religiösen Zwecken (Rastafari) verwendet werden (vgl. hierzu auch Möller, S. 114 ff.).
Cannabis wird häufig ohne ärztliche Anordnung zu kreativen Zwecken, zur Beruhigung, zur Appetitsteigerung, zur Schmerzbehandlung, als Muskelrelaxan eingesetzt. Cannabidiolhaltige Öle werden derzeit als Nahrungsergänzungsmittel zur oralen Einnahme und als Cremes im Drogeriemarkt frei gehandelt, weil sie als Ausnahme zu Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 Cannabis Nr. 1b gesehen werden (vgl. etwa das Verkaufsangebot des Drogeriemarktes DM, abrufbar unter: [folgt eine URL]).
Cannabis kann zur Steigerung sinnlicher Wahrnehmung in der Kunst eingesetzt werden (vgl. hierzu Möller, S.117 ff.). Cannabis kann zudem – wie Alkohol – zum Zwecke des Vollrausches wie auch zum Zwecke des nur geringen Rausches oder des Genusses verwendet werden. Insoweit sind bei beiden Drogen regelmäßig die Dosierung und die Art der jeweiligen Cannabisstoffe von entscheidender Bedeutung. So haben unterschiedliche Marihuanasorten unterschiedliche Wirkstoffgehalte; dies entsprechend den unterschiedlichen Alkoholika (vgl. zum Ganzen Schmidtbauer, Wolfgang/vom Scheidt, Jürgen, Handbuch der Rauschdrogen, S. 78 ff.).
Soweit das Bundesverfassungsgericht 1994 noch damit argumentierte, dass die Konsumgewohnheiten in Deutschland und dem gesamten europäischen Kulturkreis eine effektive Unterbindung von Alkohol unmöglich mache, dies für die „kulturfremde Droge Cannabis“ jedoch nicht gelte, kann dies heute nicht mehr gelten. Die Zahl der Gelegenheitskonsumenten in der Bundesrepublik wird mit bis zu vier Millionen angegeben.
Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die Cannabis bisher probiert haben, liegt bei etwa einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Von einer kulturfremden Droge kann heutzutage nicht mehr gesprochen werden und konnte nie gesprochen werden. Cannabis stand als Hanf immer auch auf deutschen und europäischen Boden und wurde auch von unseren Großvätern bereits als „ Knaster „ - Harter Tobak - konsumiert (vgl. Hans- Georg Behr, Von Hanf ist die Rede, Basel 1982, S.10). Noch bis zu Beginn der 20er Jahre des 20 Jahrhundert enthielten zahlreiche Zigarettenmarken bis zu 9 % Cannabis. Cannabis ist in der heutigen Gesellschaft dermaßen weit verbreitet, dass von einer Alltagsdroge gesprochen werden muss (so auch Möller, S.122 f.). Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die gesamte Cannabispflanze von Anlage I zum Betäubungsmittelgesetz umfasst ist, sodass nicht ausschließlich die Droge (Marihuana und Blütenstände des Cannabis), sondern auch die gesamte Nutzpflanze betrachtet werden muss.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass vom Betäubungsmittel Cannabis im Vergleich zu Alkohol gesamtgesellschaftlich gesehen wesentlich geringere Risiken ausgehen, verbietet sich insoweit eine Ungleichbehandlung im Verhältnis zu der Droge Alkohol. Aus guten Gründen ist der Umgang mit Alkohol nicht unter Strafe zu stellen. Das gilt aber auch für Cannabis.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die gegenwärtigen Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes hinsichtlich des Umganges mit dem Betäubungsmittel Cannabis mangels Vorliegen eines sachlichen Grundes für die Ungleichbehandlung mit dem Betäubungsmittel Alkohol gegen Art. 3 Abs. I GG verstoßen.
Die unterschiedliche Behandlung von Cannabis gegenüber dem Alkohol muss nach dem Vorgesagten als grob willkürlich betrachtet werden. Die Minderheit der Cannabiskonsumenten in der Bundesrepublik Deutschland dürfte die Gruppe darstellen, die ohne sachlichen Grund strafrechtlich am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird (vgl. hierzu Möller, S.123). Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland will gerade den Minderheitenschutz durch Art. 3 Abs. 1 GG im besonderen Maße gewährleisten. Der Staat jedenfalls ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt seiner Aufgabe, auch diese Minderheit zu schützen, nicht gerecht geworden. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass auch Kaffee- und Nikotinkonsum in deutschen Landen vor nicht allzu langer Zeit pönalisiert war (vgl. Schneider, Betrifft Justiz 2001, S. 37, 38). Auch soll daran erinnert werden, dass die Rechte der Frauen und der Homosexuellen trotz der Gleichheitsgrundsätze aus Art 3 GG Jahrzehnte lang durch die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkannt und in vielen Fällen erst durch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gestärkt wurden.
5. Verstoß gegen Art 6 Abs.1 und Abs. 2 GG - Ehe und Familie -
a) Art.6 Abs.1 GG
Nach Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz steht die Familie unter dem besonderen Schutz des Staates. Dieser besondere Schutz ist bei jeder Ausübung öffentlicher Gewalt zu achten und vor allem durch die Gesetzgebung zu verwirklichen (vgl. Maunz – Düring, Kommentar zum Grundgesetz zu Artikel 6 Rdnr. 1). Durch die Aufnahme von Cannabis in der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BtMG mit der Folge, dass der unerlaubte Verkehr mit diesem Stoff den Strafvorschriften des Betäubungsmittels unterliegt, kommt der Staat zur Auffassung des Amtsgerichts Bernau bei Berlin seiner besonderen Schutzaufgabe nicht nach. Seit über einem halben Jahrhundert werden Familienmitglieder und eben auch Jugendliche, die einen Umgang mit Cannabis pflegen, kriminalisiert, mit strafrechtlichen Ermittlungsverfahren versehen, mit Geldauflagen bestraft oder zu Geld- und Freiheitsstrafen oder Jugendstrafen verurteilt. Jedes einzelne Verfahren infolge des Umgangs mit Cannabis betrifft auch immer die Familie und dessen Zusammenhalt. Soweit Jugendliche, die den Umgang mit Cannabis pflegen stigmatisiert und kriminalisiert werden, obwohl sie teilweise nur sehr geringe Mengen bei sich führen, betrifft dies auch immer die gesamten Familien. Seit fünf Jahrzenten versucht der Staat mittels strafrechtlicher Gesetzgebung insbesondere Jugendliche davor zu bewahren, Cannabis zu konsumieren . Weiteres Ziel ist insoweit auch, dass sich ein problembehafteter Cannabiskonsum bei jungen Leuten nicht entwickelt. Hierzu hat der Gesetzgeber das Mittel des Strafrechts gewählt.
Bei genauer Betrachtung und im Hinblick auf die obigen Ausführungen und bei dem Wissen des Unterzeichners, der bald 25 Jahre als Jugendrichter tätig ist, hat der Gesetzgeber hierdurch keine Jugendlichen dahin gebracht, dass sie nicht zu dem Betäubungsmittel Cannabis greifen. Im Gegenteil hat die Verbotspolitik die Folge, dass gerade junge Menschen aufgrund eben des Verbotenen und im Rahmen ihres Erwachsenenwerdens gerade das Verbotene interessant finden. Infolge kommt es zur Auffassung des Gerichts zu Mehrkonsum bei Jugendlichen und damit auch zu mehr Straftaten, die schließlich durch die Jugendrichter verhandeln werden müssen. Statt sich als milderes Mittel auf einen offenen und ehrlichen Umgang und einer vernünftigen Präventionsarbeit zu konzentrieren bestreitet der Gesetzgeber trotz Kenntnis des Umstands, dass die Strafverfolgung keinerlei Auswirkungen auf den Umfang des Konsum hat, seit einem halben Jahrhundert die gleichen Wege. Er kommt hiermit seiner Aufgabe die Familien vor Eingriffen des Staates zu schützen nicht nach. Aus Erfahrung von 25 Jahren, die der Verfasser dieser Vorlage im Umgang mit Jugendlichen und Heranwachsenden hat sowie aus eigener Erfahrung aus seiner eigenen Jugend kann insoweit nur festgestellt werden, dass der Staat kontraproduktiv handelt. Denn aufgrund der Kriminalisierung von jungen Menschen, die bisweilen und gelegentlich Cannabis konsumieren, kommt es wiederholt in den Familien zu einem Streit. Nicht etwa deshalb, weil die jungen Menschen tatsächlich ein Problem mit Cannabis haben, in der Schule schlecht sind oder über keine sozialen Beziehungen mehr verfügen, sondern schlicht und einfach deswegen, weil sie sich nicht an die Gesetzeslage halten, sie möglicherweise vor Gericht landen und die Eltern aufgrund von Unwissenheit Angst vor einer Verwahrlosung ihrer Kinder haben.
Oftmals wird ihnen auch eine Cannabissucht unterstellt, die objektiv nicht gegeben ist. Die Jugendlichen haben darüber hinaus keine Möglichkeit mit ihren Eltern frei und ohne das Damoklesschwert der Strafverfolgung über ihren Cannabiskonsum zu sprechen. Sofern sie tatsächliche Probleme haben offenbart sich dieses Problem in aller Regel viel zu spät, da die Eltern eben auch durch die Strafverfolgung bedingt sich nicht rechtzeitig mit diesen Problematiken auseinandersetzen können oder wollen.
Abgesehen von dem zuvor ausgeführten schafft die Cannabisprohibition unter Jugendlichen auch immer eine Szene, in der es darum geht, das Verbotene in Opposition zu den Eltern zu machen. Das Gericht hat des Weiteren immer wieder Begleitkriminalität zu verhandeln gehabt. So z.B Bedrohungen dahingehend, ich sage es den Eltern oder den Lehrern. Erpressungen dahingehend, dass das Cannabis noch bezahlt werden muss und bisweilen sogar räuberische Erpressung oder Raub, um den gleichfalls aus der Jugendszene kommenden jugendlichen Dealer zu bezahlen. Diese Fälle gäbe es nicht, wenn die jungen Menschen offen und ehrlich mit ihren Eltern, die dann die Schutzfunktion ausüben könnten, sprechen dürften.
Bei genauer Betrachtung handelt der Staat mithin weder zum Schutze der Jugendlichen noch zum Schutze der Familien der Jugendlichen. Er bereitet Streit in den Familien und schafft es, dass Eltern ihre Kinder anzeigen, weil sie vermeintlich einen problembehafteten Cannabiskonsum feststellen oder aber auch dafür sorgen wollen, dass ihre eigenen Kinder sich rechtstreu verhalten. Sie haben keinen Blick darauf, dass es der Staat und der Gesetzgeber ist, der für die Verbotspolitik verantwortlich zeichnet. Diese Verbotspolitik schafft im Übrigen auch enorme Ängste dahingehend, dass junge Menschen die vielleicht einoder zweimal Cannabis ausprobiert haben, gleich in die Verwahrlosung abstürzen und auch dahingehend, dass die Kinder möglicherweise strafrechtlich belangt werden. Schließlich schafft es der Staat mit der Kriminalisierung nicht, die wirklich problembehafteten Fälle frühzeitig zu erkennen. Das sind auch Auswirkungen der Verbotspolitik.
Dem vorlegenden Gericht ist klar, dass ein Verstoß gegen Artikel 6 Abs.1 GG bislang in der rechtswissenschaftlichen Literatur nicht diskutiert wurde. Gleichwohl erachtet das Gericht bei der durch Ideologie und mangelnden Sachverstand geprägten Gesetzgebung einen Verstoß gegen Artikel 6 Abs.1 Grundgesetz für gegeben. Dieser ist zu mindestens zu diskutieren.
b) Verstoß gegen Art 6 Abs.2 GG
Die Cannabiskriminalisierung enthält darüber hinaus einen weiteren Verstoß,nämlich gegen Artikel 6 Abs. 2 GG: Hiernach ist Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
Hiergegen steht die gegenwärtige Gesetzeslage, die bereits bei geringen Überschreitungen Strafverfahren gegen Jugendliche einleitet. Hier müssen die Jugendlichen zur Polizei, zur Jugendgerichtshilfe und schließlich in vielen Verfahren dann auch zum Jugendrichter. Eltern erhalten zeitgleich Ladungen zur jugendrichterlichen Termin, den sie nachkommen müssen. Der Staat greift hier enorm in das Erziehungsrecht der Eltern ein, ohne hierdurch auch nur tatsächlich eine Erziehung auszuüben. Sie nimmt aufgeklärten Eltern, die sich mit der Problematik eines Cannabiskonsums auseinandersetzen wollen, die Möglichkeit ihre Kinder, spricht Jugendliche, selbst zu erziehen und übergibt dieses Recht ohne einen Vorteil hierdurch zu haben den Jugendgerichten. Dies mit der Folge, dass Jugendliche stigmatisiert werden, in den Familien Auseinandersetzungen erfolgen und insoweit das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch insoweit verstößt der Gesetzgeber ebenfalls in Kenntnis dieser Umstände mit seiner Verbotspolitik gegen Originäre aus dem Grundgesetz genommene Rechte der Eltern.
5. Zusammenfassung
Nach alledem kommt das Gericht zur sicheren Überzeug, dass die Cannabiskriminalisierung mit den genannten sich aus dem Grundgesetz ergebenen Rechte der Bürger heute nicht mehr in Einklang zu bringen ist. So zur Überzeugung des Amtsgerichts Bernau bei Berlin sicher gegen das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit, gegen die Freiheitsrechte und den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz sowie schließlich auch auf das Recht auf Schutz von Familie und Erziehung. Aber auch hinsichtlich der Glaubensfreiheit und der Kunstfreiheit ergeben sich Bedenken, ohne dass das vorlegende Gericht dies weiter erörtert hat (vgl. insoweit Möller a.a.O S.
Verfassungswidrigkeit des §29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BtmG und des Auffangtatbestandes der Nr.3 i. V. m. der Anlage zu §1 Abs.1 BtMG insoweit als hierdurch auch Konsumenten von Cannabis pönalisiert werden.
Sofern das Bundesverfassungsgericht jedoch nach wie vor entgegen der internationalen und nationalen Entwicklungen Risiken für die Volksgesundheit und für den Jugendschutz bejahen sollte bzw. dem Gesetzgeber hinsichtlich der Grundkonzeption der Cannabiskriminalisierung eine nach wie vor bestehende Entscheidungsprärogative zubilligt, mithin die Aufnahme in der Anlage 1 zu § 1 Abs.1 BtMG von Cannabisprodukten für grundsätzlich verfassungsgemäß erachtet, verstößt zur Auffassung des Amtsgerichts jedenfalls die Regelung, dessen Überprüfung hilfsweise dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt wird, in vielerlei Hinsicht gegen Grundrechte.
A.
Verfahrensgeschichte, Sachverhalt und rechtliche Würdigung
1. Verfahrensgeschichte und Sachverhalt
Am 02.01 2019 erwarb der Angeklagte in Berlin-Kreuzberg im Görlitzer Park – einem bekannten Drogenumschlagsplatz - von einer unbekannt gebliebenen Person 2,6 g Marihuana.
Er fuhr dann mit dem im Bundesland Berlin erworbenen Marihuana in seine Heimatgemeinde Schönow ins Bundesland Brandenburg. gelegen etwa 15 Kilometer von der Landesgrenze Berlin / Brandenburg. In den Stunden danach war er hier mit einem Freund unterwegs und führte das erworbene Marihuana mit sich. Im Rahmen einer durch die Brandenburgische Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs erfolgten Tatortortbereichsfahndung in anderer Sache wurde der Angeklagte wie sein Freund gegen 0:00 Uhr des 03.01.2019 festgestellt. Im Rahmen der Feststellungen bemerkten die ermittelnden Beamten starken Cannabisgeruch und durchsuchten infolge den Angeklagten. Hier fanden sie die in Berlin erworbenen 2,6 g Marihuana. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde das Verfahren nunmehr an die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zur weiteren Veranlassung und Entscheidung übersandt. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Angeklagte bereits einmal wegen Cannabisbesitzes im Land Brandenburg in Erscheinung getreten war ( s.o. ) und entsprechend der Richtlinien zur Einstellung bei Cannabisdelikten gemäß § 31 a BtMG des Landes Brandenburg hinsichtlich Wiederholungstätern, beantragte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit Verfügung vom 07.05.2019 wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gemäß §§ 29 Abs. 1 Nr. 3, 33 BtMG den Erlass eines Strafbefehls in Höhe von 20 Tagessätzen zu je 30,00 € (gleich 600,00 €). Auch wurde beantragt ihm die Kosten des Verfahrens gemäß § 465 StPO aufzuerlegen. Sofern der Angeklagte allerdings im Bundesland Berlin aufgegriffen worden wäre, hätte die dann nach dem Tatortprinzip zuständige Staatsanwaltschaft Berlin entsprechend der Richtlinien des Landes Berlin zur Einstellung der Verfahren bei Cannabisdelikten und des Umstandes, dass auch bei Wiederholungstätern eingestellt wird, das Verfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingestellt.
Der Angeklagte hatte mithin schlichtweg Pech, dass er im Bundesland Brandenburg und nicht im Bundesland Berlin mit dem erworbenen Marihuana festgestellt wurde.
Nach Eingang des Strafbefehlsantrages mit Datum vom 03.06.2019 und einer ersten Vorprüfung durch das Gericht eröffneten sich nicht nur grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Strafbarkeit bezüglich des gesamten Umgehens mit dem Betäubungsmittel Cannabis sondern auch bezüglich der Konsumentenverfolgung. Dies insbesondere unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Entscheidung vom 9.3.1994, BVerfGE 90.145 ff.) die gemäß § 31 Abs..1 BVerfGG Staatsanwaltschaft und Rechtsprechung bindet. Einer früheren Entscheidung mithin der aus dem Jahr 1994 kommen gemäß § 31 Abs.2 BVerfGG Gesetzeskraft und Rechtskraftwirkung zu (vgl. BVerfGE 33,199, BVerfGE zu 2 Bvl 8/02 ).
Der Angeschuldigte wurde mit Datum vom 26.07.2019 hierauf aufmerksam gemacht und bezüglich der Bestellung eines Pflichtverteidigers angeschrieben. Infolge wurde mit Datum vom 19.08.2019 gemäß § 140 Abs. 2 StPO eine Pflichtverteidigerin bestellt. Zeitgleich wurde gemäß § 408 Abs. 3 Satz 2 StGB eine Verhandlung anberaumt, da das Gericht zur Auffassung gelangt ist, dass von der rechtlichen Beurteilung der Staatsanwaltschaft vorliegend abgewichen werden könnte.
Im Rahmen der Hauptverhandlung erklärte der Vorsitzende, dass eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit nach § 31a BtMG oder 153 StPO angezeigt sei und dies bereits vorher seitens der Staatsanwaltschaft angezeigt gewesen wäre. Weder der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Verteidigerin noch der Angeklagte erteilten zur Einstellung ihre notwendige Zustimmung.
Der Angeklagte erklärte insoweit
| „ich fühle mich nicht schuldig“. |
Die Beweisaufnahme wurde sodann im allseitigen Einverständnis geschlossen. Im Rahmen der sodann gehaltenen Plädoyers beantragte die Staatsanwaltschaft nunmehr den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen zu je 10,00 € kostenpflichtig zu verurteilen und die sichergestellten Betäubungsmittel einzuziehen. Die Verteidigerin beantragte in Übereinstimmung mit dem Angeklagten einen Freispruch bzw. eine Aussetzung des Verfahrens gemäß Art. 100 GG mit der Zielsetzung die anzuwendenden Betäubungsmittelvorschriften überprüfen zu lassen.
2. Rechtliche Würdigung:
Aufgrund des festgestellten Sachverhalts hat sich der Angeklagte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG in der Alternative des Erwerbens in Verbindung mit der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BtMG strafbar gemacht (vgl. insoweit I Nr. 3 dieser Vorlage).
An einer Bestrafung des Angeklagten sieht sich das Gericht, selbst wenn man die Gesamtkonzeption des Gesetzgebers bezüglich des Umgangs mit Cannabis noch für verfassungsgemäß erachtet hätte, was wie oben dargelegt nicht der Fall ist, dennoch gehindert. Denn das Gericht ist zur sicheren Überzeugung gelangt, dass die hier zur Anwendung kommende Vorschrift des Betäubungsmittelgesetzes in Verbindung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 nach Maßgabe des Beschlusstenors jedenfalls soweit lediglich Konsumentenverhalten unter Strafe gestellt wird, verfassungswidrig ist. Denn wenn die Bestrafung von Cannabiskonsumenten selbst bei Umgang mit geringen Mengen wie vorliegend gemäß § 29 BtMG gegen das Grundgesetz i.V.m. der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstößt, darf das Gericht den Angeklagten nicht bestrafen oder gemäß § 29 Abs.5 BtMG auch nicht von Strafe absehen.
Sofern das Gericht nämlich von Strafe abgesehen hätte, hätte es zeitgleich die Schuld des Angeklagten feststellen und ihm auch die Verfahrenskosten auferlegen müssen. Abgesehen davon hätte er sich voraussichtlich aufgrund einer Berufung der Staatsanwaltschaft einem Berufungsverfahren mit einer weiteren Kostenlast stellen müssen. Hinsichtlich weiterer rechtlicher Folgen wird auf I .Nr.3 dieser Vorlage verwiesen.
Der Angeklagte wäre mithin freizusprechen wenn die vorgenannte Vorschrift des Betäubungsmittelgesetzes hingegen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar wäre. Das Gericht musste daher das Verfahren auch insoweit aussetzen und gemäß Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen.
B.
Zulässigkeit der Vorlage bezüglich der hilfsweise zur Überprüfung gestellten Norm des § 29 Abs.1 Nr. 1 BtMG
1. Bisherige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
a) Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vom 9.3.1994 (BVerfGE 90,145 ff. )
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner bereits wiederholt zitierten Entscheidung vom 9.3.1994 die Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes soweit der generelle Umgang mit Cannabis unter Strafe gestellt wurde, letztlich für verhältnismäßig erachtet. Allerdings nur deswegen, weil der Gesetzgeber es den Strafverfolgungsorganen ermöglicht hat, durch das Absehen von Strafe (vgl. § 29 Abs. 5 BtMG) oder Strafverfolgung (vgl. §§ 153 ff. StPO, § 31a BtMG) einem geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt der Tat Rechnung zu tragen. Soweit Verhaltensweisen mit Strafe bedroht seien, die ausschließlich den gelegentlichen Eigenverbrauch geringer Mengen von Cannabisprodukten vorbereiten und nicht mit einer Fremdgefährdung verbunden sind, würden sie deshalb nicht gegen das Übermaßverbot verstoßen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Strafverfolgungsorganen aufgegeben, in diesen Fällen nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31a BtMG bezeichneten Straftaten grundsätzlich abzusehen haben. Es mahnte zugleich eine einheitliche Regelung auf der gesamten Bundesebene an (vgl. BVerfGE 90, 145, 190/191).
Des Weiteren stellte das Bundesverfassungsgericht bereits 1994 fest, dass die Abwägung zwischen dem Eingriff in die Grundrechte und dem Schutz von Rechtsgütern hinsichtlich des Umgangs mit geringen Mengen Cannabis die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der diesbezüglichen Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes zur Folgen haben könnte (vgl. BVerfGE, 90, 145, 185). Insoweit führte das Gericht seinerzeit aus, dass gerade in Fällen, in denen die Cannabisprodukte lediglich in geringen Mengen zum gelegentlichen Eigenverbrauch erworben und besessen würden, das von der Tat ausgehende Maß der Rechtsgütergefährdung und individuellen „Schuld“ sehr gering sein könne. Insgesamt sei der individuelle Beitrag der Kleinkonsumenten zur Verwirklichung der Gefahren, vor denen das Verbot des Umgangs mit Cannabisprodukten schützen solle, gering. Bei welcher Menge die Feststellung einer geringen Schuld zur Folge haben könne ließ das Bundesverfassungsgericht seinerzeit offen.
Dem Übermaßverbot sollte durch verfahrensbeendende Einstellungsmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft bzw. durch das Absehen von Strafe nach § 29 Abs. 5 BtMG letztlich genüge getan werden. Das Bundesverfassungsgericht entschied sich seinerzeit für eine prozessuale Lösung, um dem Übermaßgebot und damit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Rechnung zu tragen. Eine materiell - rechtliche Lösung dahingehend, dass der Gesetzgeber verpflichtet sei eine Strafverfolgung von Konsumenten zu verhindern, indem er von vornherein Konsumenten bis zu einer festzusetzenden Menge straflos stellt, wurde zwar diskutiert aber nicht verlangt ( vgl. abweichende Ansicht Sommer BVerfGE 90,145, S. 212 ff.).
b) Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vom 29.06.2004 – 2 BVL 8/02 -
Mit Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 29.06.2004 – 2 BVL 8/02 – auf den Vorlagebeschluss des Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.03.2002 wurde im Ergebnis festgestellt, dass die Vorlage den Begründungsanforderungen für eine erneut Richtervorlage nicht ausgereicht habe. In der Entscheidung wurden Begründungsanforderungen wie folgt festgelegt:
| „Das vorlegende Gericht ist gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG an die frühere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gebunden. Ihr kommen gemäß § 31 Abs. 2 BVerfGG Gesetzeskraft und Rechtskraftwirkung zu (vgl. BVerfGE 33, 199 (203) m. w. N.). Da das vorlegende Gericht im Falle einer erneuten Vorlage einen Spruch begehrt, der im Gegensatz zu der früheren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht, muss es im Einzelnen die Gründe dafür darlegen, dass die Rechtskraft der früheren Entscheidung eine erneute Sachprüfung nicht hindert. Die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung bezieht sich zwar stets auf den Zeitpunkt, in dem sie ergeht; sie erfasst damit nicht solche Veränderungen, die erst später eintreten. Sie steht einer erneuten Vorlage daher nicht entgegen, wenn das vorlegende Gericht sich auf neue Tatsachen beruft, die erst nach der früheren Entscheidung entstanden oder bekannt geworden sind. Eine erneute Vorlage ist in solchen Fällen aber nur dann zulässig, wenn sie von der Begründung der früheren Entscheidung ausgeht; das vorlegende Gericht muss den in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dokumentierten Rechtsstandpunkt einnehmen und neue Tatsachen darlegen, die vor diesem Hintergrund geeignet sind, eine von der früheren Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts abweichende Entscheidung zu ermöglichen.“ |
Da das Bundesverfassungsgericht 2004 im Rahmen einer Kammerentscheidung die Vorlage des Amtsgericht Bernau bei Berlin bereits als unzulässig gewertet hatte, erfolgte mithin eine Sachentscheidung nicht. Bezüglich der seinerzeit durch das Amtsgericht Bernau bei Berlin bereits gerügten uneinheitlichen Einstellungspraxis der Strafverfolgungsbehörden führte das Bundesverfassungsgericht lediglich aus, dass die Darlegungen in sich widersprüchlich seien und daher nicht geeignet seien, die gesetzliche Konzeption in Zweifel zu ziehen. Eine Begründung hierfür erfolgte nicht.
Unter Würdigung beider zuvor dargelegten Entscheidungen hat sich das vorlegende Gericht, da 2004 keine Sachentscheidung ergangen ist, mithin lediglich an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 09.März 1994 zu orientieren und von der Begründung dieser Entscheidung auszugehen (vgl. zu Kammerbeschlüssen BVerfGE Bd. 92,91,107).
Das Bundesverfassungsgericht hatte 1994 festgestellt, dass die Vorschriften des „CannabisStrafrechts“, die ausschließlich den gelegentlichen Eigenverbrauch geringer Mengen von Cannabis vorbereiten und nicht mit einer Fremdgefährdung verbunden sind, deshalb nicht gegen das Übermaßverbot verstoßen, weil der Gesetzgeber es den Verfolgungsorganen ermögliche, durch das Absehen von Strafe oder Strafverfolgung einem geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt der Tat Rechnung zu tragen. Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete insoweit die Strafverfolgungsorgane nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31 a BtMG bezeichneten Straftaten grundsätzlich abzusehen (BVerfGE Urteil vom 9.03.1994, 2 BvR 2031/92, Leitsatz Nr. 3). In seiner Begründung hat das Bundesverfassungsgericht es als bedenklich angesehen, wenn es bei einer 1994 festgestellten unterschiedlichen Einstellungspraxis in den verschiedenen Bundesländern bliebe (BVerfGE 90,145,190). Als zentrale Differenzpunkte wurden dabei die Bestimmungen zur geringen Menge und die rechtliche Behandlung von Wiederholungstätern genannt (BVerfGE Urteil vom 09.03.1994, 2 BvR 2031/92, Rn. 167). Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete insoweit die Länder, für eine im Wesentlichen einheitliche Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften zu sorgen. Eine solche im Wesentlichen einheitliche Einstellungspraxis sei nicht gewährleistet, sofern „die Behörden in den Ländern durch allgemeine Weisungen die Verfolgung bestimmter Verhaltensweisen nach abstrakt-generellen Merkmalen wesentlich unterschiedlich vorschrieben oder unterbänden“ (BVerfGE 90,145,190). Das Bundesverfassungsgericht hat mithin 1994 deutlich gemacht, dass im Bereich der Strafverfolgung und speziell auch bei der verfassungsrechtlich gebotenen Anwendung der diversen Einstellungsvorschriften aufgrund des Übermaßverbotes im Bereich der mit dem Umgang mit Cannabisprodukten aufgeführten Strafvorschriften eine einheitliche Rechtsanwendungspraxis geboten sei.
2. Neue entscheidungserhebliche Tatsachen
26 Jahre nach Ergehen des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 und unter der Berücksichtigung der oben dargelegten neueren wissenschaftlichen und tatsächlichen Erkenntnisse ist das Amtsgericht Bernau bei Berlin zur festen Überzeugung gelangt, dass jedenfalls heute neue entscheidungserhebliche Tatsachen vorliegen (vgl. oben zu II) und dass die damals durch das Bundesverfassungsgericht gewählte sogenannte prozessuale Lösung verfassungswidrige Eingriffe in die Rechte von Bürgern nicht zu verhindern vermochte. Bereits der hier dem Bundesverfassungsgericht vorgelegte Fall zeigt, dass nach wie vor trotz der Einstellungsmöglichkeiten durch die Staatsanwaltschaft gegen das Übermaßverbot verstoßen wird. Abgesehen davon wird – insofern gerichtsbekannt – in tagtäglicher Praxis jährlich in zehntausenden Fällen gegen das Übermaßverbot verstoßen.
Dies wird bereits durch die regelmäßig durch das statistische Bundesamt jährlich veröffentlichten Strafverfolgungsstatistiken belegt.
So wurden alleine wegen konsumnaher Delikte nach § 29 BtMG in den Jahren 2009 bis 2015 laut Strafverfolgungsstatistik folgende Zahlen an Verurteilten und Abgeurteilten bezüglich aller Betäubungsmittel festgestellt. (vgl. Körner/Patzak/Volkmer Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz 9.Auflage zu § 29 Rdnr. 21, vgl. auch [folgt eine URL]).
| [folgt eine Tabelle] |
Auch wenn es in der Strafverfolgungsstatistik keine konkrete Aufschlüsselung nach der Art des Betäubungsmittels gibt, wegen dem verurteilt wurde, dürften, trotz einer Einstellungsquote bei Cannabiskonsumenten von durchschnittlich 2/3, mit Blick auf die jährlich steigenden Zahlen konsumbezogener Cannabisdelikte (laut Polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr 2018 : 179700 Fälle und im Jahr 2019 : 186455 Fälle ) nach wie vor jährlich und zwar überwiegend mittels des Strafbefehlsverfahrens zwischen zwanzig und dreißigtausend Menschen auch wegen Besitzes, Erwerbens oder sonstigen Verschaffens von Cannabis, selbst bei sehr geringen Mengen, durch deutsche Straf- und Jugendgerichte verurteilt worden sein.
So machten im Jahr 2018 konsumbezogene Cannabisdelikte mit 179.700 registrierten Fällen 51% aller Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aus (insgesamt 350.662 Fälle, vgl.: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Hiervon sind 82% aller erfassten Ermittlungsverfahren wegen Delikten mit Cannabisbezug rein auf Konsumenten bezogen (vgl. ebd.). Dies entspricht etwa einer jährlichen Zahl von 70000 Fällen. Selbst bei einer hoch geschätzten Einstellungsquote in 2/3 aller Fälle verbleiben noch konservativ berechnet um die 20000 Fälle, in denen verurteilt wird. Dies entspricht in etwa auch der Anteile bezüglich der zuvor dargestellten polizeilichen Strafverfolgungsstatistik.
Entgegen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes sind die Einstellungsrichtlinien der Länder noch immer uneinheitlich, soweit es geringe Mengen zum Eigenbedarf betrifft.
Bundeseinheitliche Richtlinien gibt es nicht. Regelmäßige Versuche der Länder im Rahmen der Justizministerkonferenzen, eine einheitliche bundesweit geltende Regelung zu verabschieden, scheiterten immer wieder an den jeweils durch vorhandene unterschiedlichen Ansichten bezüglich der zugrunde zu legenden Mengen bzw. der gegebenenfalls zu privilegierenden Personen. Vielmehr gaben sich die Bundesländer unterschiedliche Richtlinien (Körner, Hans-Harald/ Patzak, Jörn/ Volkmer, Mathias, BtmG Kommentar, § 31a BtMG, Rn. 42 ff., 9. Aufl. 2019 nachfolgend zitiert als Körner). Die Versuche der Beschränkung eines Tatbestandes mit Mitteln des Prozessrechts durch Weisungen der Staatsanwaltschaften der Länder führte und führt dazu, dass die befassten Strafverfolgungsbehörden über die uneinheitliche Anwendung des Opportunitätsprinzips auch uneinheitlich bestimmen; aufgrund des Föderalismus kann es so gut wie keine richterliche, insbesondere höchstrichterliche und schon gar nicht bundeseinheitlich höchstrichterliche Kontrolle der Einstellungen geben. Die Strafverfolgungsbehörden bestimmen daher weitgehend unkontrolliert selbst, was strafbar ist (vgl. hierzu auch Möller, S. 72 ff, 124 ff.).
Bei Sichtung der Richtlinien offenbaren sich bei der Bestimmung der geringen Mengen von Cannabisprodukten sowie weiterer Voraussetzungen erhebliche Unterschiede. Trotz des Umstandes , dass mittlerweile 12 Bundesländer 6 Gramm Bruttogesamtgewicht an Cannabis als einstellbare Menge ausweisen, zeigen sich doch erhebliche Unterschiede in den Richtlinien ( Vgl. zu den bis 2019 bestehenden Richtlinien Körner zu § 31a BtMG Rdnr. 43 ) Ausnahmen hiervon sind Berlin, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Zum 1.4. 2020 änderte das Bundesland Bremen seine Richtlinien im Sinne einer Verbesserung für den Konsumenten dahingehend , dass nunmehr bei Mengen bis zu 15 Gramm eingestellt werden kann, womit zur Zeit noch 11 Bundesländer die 6 Gramm Regelung haben.
Die Schwankungsbreite von Kann-Einstellungen variieren von 6 über 10 bis 15 Gramm, wobei Berlin als einziges Bundesland eine Regelung hat, wonach bei einem Bruttogewicht von bis zu 10 Gramm eingestellt werden muss und einer Menge von bis zu 15 Gramm, bei der eingestellt werden kann. In den übrigen Bundesländern wird jedwede Einstellung in das Ermessen der Staatsanwaltschaft gestellt, wobei die Richtlinien nicht zeigen, in welch unterschiedlichem Ausmaß die Staatsanwaltschaften von dem gewährten Ermessen Gebrauch zu machen haben. Die Richtlinien zeigen weiter bedeutsam-unterschiedliche Vorgaben für „Wiederholungstäter“ (vgl. etwa Baden-Württemberg: eine Anwendung des 31a BtMG auf Dauerkonsumenten und Wiederholungstäter ist grundsätzlich nicht vorgesehen, siehe Körner a.a.O. Rn. 46, andererseits Berlin: Der Anwendung des § 31a BtMG steht grundsätzlich nicht entgegen, dass die beschuldigte Person bereits mehrfach wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurde oder dass das Ermittlungsverfahren nach § 31a BtMG eingestellt wurde, Körner, a. a. O. Rn. 48).Im Rahmen der unterschiedlich ausgestalteten Richtlinien der Länder( vgl. zu den Einzelheiten Körner a.a.O zu § 31a BtMG Rdnr.46 bis 64) werden Wiederholungstäter trotz der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts - wie der vorliegende Fall eindeutig zeigt - unterschiedlich behandelt. Dies eindeutig in Verkennung des Wortes "Gelegentlich" aus der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Denn gelegentlich bedeutet nun mal, dass Menschen wiederholt Cannabis gebrauchen und infolge auch mehrmals polizeilich festgestellt werden können. Schon hier wird deutlich ohne dass derzeit empirisches Material zu der Rechtswirklichkeit zu den Einstellungspraxen vorliegt, dass unterschiedliche Grenzbestimmungen der Länder, unterschiedliche Richtlinien hinsichtlich der Gewährung der Einstellungsmöglichkeit bei „Wiederholungstätern“ vorliegen. Neben den Unterschieden bei den Richtlinien kann unterstellt werden, dass es auch unterschiedliche Strafverfolgungskulturen der Staatsanwaltschaften in den jeweiligen Bundesländern gibt, die bei gleichem Sachverhalt Kleinstbesitzer unterschiedlich und nicht einheitlich behandeln. Ob eine regelmäßige Anwendung des § 31a BtMG etwa in Berlin bei „Wiederholungstätern“ regelmäßigen Anklagen und gegebenenfalls auch Urteilen etwa in Baden-Württemberg gegenüberstehen, liegt nahe. Die Richtlinien aller Bundesländer – außer Berlins – lassen es offen, ob auch bei nur geringen Mengen bisweilen angeklagt wird und abgeurteilt werden kann. Aktuelle Studien zur Strafverfolgungspraxis liegen trotz des bestehenden Prüfauftrages durch das Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 1994 nicht vor.
Die letzte insoweit durch das Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebene Studie wurde im Jahre 2006 von Schäfer/ Paoli unter dem Titel Drogenkonsum und Strafverfolgungspraxis veröffentlicht. Im Auftrag gegeben wurde diese Studie im Herbst des Jahres 2002 und im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.03.2002 (vgl. - BVerfGE zu 2vl 8/02 -). Seinerzeit hatte das Amtsgericht Bernau bei Berlin bereits die unterschiedlichen Richtlinien der Bundesländer gerügt.
Im Ergebnis kam die Studie von Schäfer/ Paoli dazu, dass eine im Jahre 1997 bereits erfolgte Studie der Autorin Aulinger ( vgl. Aulinger, Rechtsgleichheit und Rechtswirklichkeit bei der Strafverfolgung von Drogenkonsumenten),die von einer im wesentlich gleichen Strafverfolgung ausging, keine Bestätigung finden konnte. Vielmehr kommt die Schäfer/Paoli Studie dazu, dass es eine zwar „weitgehende „ aber eben keine einheitliche Einstellungspraxis nur bis zu einer Menge von 6 Gramm bei Ersttätern und Ausschluss weitere Einflussfaktoren gebe. Bei Wiederholungstätern und auch bei Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende gäbe es dagegen große Unterschiede. Diese seien auch teilweise von Staatsanwaltschaft zur Staatsanwaltschaft unterschiedlich. Auch gebe es Unterschiede bezüglich der Frage, ob mit oder ohne Geld- oder Arbeitsauflage eingestellt würde (vgl. Schäfer/ Paoli Seite 316/317).
Insgesamt und mit der Kenntnis des Gerichts wird jedoch, wie auch der vorliegende Fall zeigt, gegen die Vorgaben des Bundesverfassungsgericht verstoßen. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, weswegen Bürger von Bundesland zu Bundesland sowohl hinsichtlich der Mengen als auch bezüglich weiterer Faktoren unterschiedlich behandelt werden und trotz weitgehender Praxis – eben nur weitgehende Praxis - in sehr vielen Fällen bundesweit gegen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts verstoßen wird.
Hinzu kommen, neben unterschiedlichen Einstellungsvorgaben und Einstellungspraxen, erhebliche Unterschiede in der Strafverfolgungswirklichkeit. Durchsuchungen der Person und der Wohnung, erkennungsdienstliche Maßnahmen, Beschuldigtenvernehmungen, Fragen, die über den Besitz geringer Mengen zum Eigenbedarf hinausgehen und etwa Fragen nach dem Verkäufer, der Erwerbshäufigkeit, Fragen nach der Einfuhr etc. nach sich ziehen, gehen einer Einstellung in vermutlich allen Bundesländern – außer Berlin, wenn es sich um eine Bruttomenge von weniger als 10 Gramm handelt und die weiteren Voraussetzungen der Richtlinie Berlin gegeben sind – vorweg. In den Fällen der Ermessensausübung haben die Einstellungsvorgaben der anderen Bundesländer Auswirkungen auf die Ermittlungstätigkeit der Polizei. Diese ermittelt, bis die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen ausübt, gegebenenfalls bis zur Wohnungsdurchsuchung oder gar Körpervisitation auf der Suche nach mehr. Besitzer geringer Mengen zum Eigenbedarf, fern von Schulen und Vollzugsanstalten und ohne Erzieher oder Beamter zu sein, wissen nicht, ob ihr Ermittlungsverfahren eingestellt werden wird. Die Angst vor straf-, berufs- oder aufenthaltsrechtlichen Folgen wird nach der „prozessualen Lösung“ des § 31a BtMG nicht vermieden. Für Beschuldigten ist die drohende Strafverfolgung in Baden-Württemberg und Bayern wie auch in Brandenburg eine andere Last und Sorge, als für die Beschuldigte in Berlin.
3. Zusammenfassung
Untern Berücksichtigung der oben zu II dargelegten neuen Erkenntnisse, der nach wie vor nicht bestehenden unterschiedlichen Einstellungspraxis der Bundesländer, der hiermit verbundenen tagtäglichen Verfolgung von Konsumenten und der oben dargelegten Verurteilungszahlen ist die erneute Vorlage zur Auffassung des Gerichts auch bezüglich des hilfsweise zur Überprüfung gestellten § 29 BtMG auch zulässig.
C.
Begründetheit der hilfsweise zur Überprüfung gestellten Norm
Unter genauer Betrachtung des zuvor dargelegten Geschehens und der gewonnenen Erkenntnisse hat der Staat durch seine vielfältigen Eingriffe in die Rechte des von Amtswegen zu verfolgenden Bagatellkonsumenten eingegriffen und nach Ansicht des Amtsgerichts Bernau bei Berlin regelmäßig deren verfassungsrechtlich verankerte Grundrechte außer Acht gelassen.
So steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die Regelungen des § 29 Abs. 1 Nr.1BtMG und des Auffangtatbestandes der Nr.3 BtMG, soweit sie zur Entscheidung vorgelegt wurden, jedenfalls hilfsweise gegen folgende Grundrechte und verfassungsrechtliche Regelungen verstoßen:
1. Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG
Der § 29 Abs.1 Nr. 1 und Nr. 3 BtMG i.V. m mit der Anlage I zu § 1 ABs.1 BtMG verstößt, soweit das Umgehen mit dem Betäubungsmittel Cannabis unter Strafe gestellt wird, gegen das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit.
Unter Berücksichtigung des bereits dargelegten Erkenntnisstandes des Gerichts sind die Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes, soweit sie Verhaltensweisen mit Strafe bedrohen, die ausschließlich den gelegentlichen Eigenverbrauch geringer Mengen von Cannabisprodukten vorbereiten und nicht mit einer Fremdgefährdung verbunden sind mit dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht mehr in Einklang zu bringen. Da die Strafverfolgung bereits mit der Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden von der Tat beginnt und Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger bedingen, müssen diese zur Prüfung gestellten Strafvorschriften daher bereits mangels Vorliegen eines legitimen Zwecks als verfassungswidrig bezeichnet werden. Sie sind darüber hinaus nicht geeignet und auch nicht erforderlich (vgl. insoweit oben zu A.1.) und insgesamt nicht verhältnismäßig.
So hat sich der Cannabiskonsument zunächst einer polizeilichen Überprüfung zu unterziehen, die in jedem Fall mit einer Beschuldigtenvernehmung und gegebenenfalls auch mit seiner vorläufigen Festnahme verbunden ist. Im Rahmen der Strafprozessordnung besteht sodann die Möglichkeit, erkennungsdienstlichen Maßnahmen, Personenkontrollen und auch Hausdurchsuchungen seitens der Ermittlungsbehörden durchzuführen. Nachdem diese Maßnahmen getroffen und mithin bereits diverse Eingriffe in die Grundrechte der Bürger erfolgt sind, ist die Staatsanwaltschaft nach dem Legalitätsprinzip gemäß § 152 Abs. 2 StPO zunächst einmal verpflichtet einzuschreiten. In Durchbrechung des Legalitätsprinzips kann sie nach dem so genannten Opportunitätsprinzip sodann hinsichtlich des Umgangs mit geringer Mengen Cannabis gemäß §31 a Abs. 1 BtMG von der Verfolgung absehen. Macht sie dies nicht, hat sie noch die Möglichkeit gegebenenfalls mit Zustimmung des Gerichts gemäß den §§ 153, 153 a StPO von der Verfolgung abzusehen. Wendet sie § 153 a StPO an, so ist auch damit bereits ein Eingriff in die Grundrechte des Beschuldigten verbunden. Denn Auflagen, die ihm gemäß dieser Vorschrift auferlegt werden können, haben zwar keinen Strafcharakter, sind jedoch immer noch als besondere nichtstrafrechtliche Sanktion „zu kennzeichnen“ (vgl. Meyer-Goßner7Schmitt, StPO Kommentar, 61 Aufl. zu § 153 a, Rdnr. 12). Erhebt die Staatsanwaltschaft sodann unter Verletzung des Übermaßverbotes Anklage oder beantragt den Erlass eines Strafbefehls wie im vorliegenden Verfahren, so hat sich der Bürger bereits einem gerichtlichen Verfahren zu unterziehen. Er hat den Ladungen des Gerichts Folge zu leisten und kann gegebenenfalls mittels Zwang zu einer Hauptverhandlung zugeführt werden, so mit den Mitteln des Vorführungsbefehls oder dem Erlass eines Haftbefehls. Erst hiernach kommt es zur Hauptverhandlung und der Angeklagte, der mittlerweile einer vielfältigen Eingriffsserie in seinen Grundrechten unterzogen wurde, kann darlegen, dass das gesamte Verhalten der Staatsanwaltschaft gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot verstoße.
Im Falle, dass das Gericht sodann gleichfalls von einer Verletzung des Übermaßverbotes ausgeht und gem. §29 Abs. 5 BtMG die Schuld des Angeklagten feststellt und von der Strafe absieht, hat es dem Angeklagten weiter mit der Kostenfolge des § 465 Abs. 1 Satz 2 zu belegen. Auch dies stellt eine sanktionsähnliche und mit einem in das Grundrecht des angeklagten Bürger verbundenen Eingriff dar. Schließlich wird hinsichtlich aller zuvor beschriebener Verfahrensbeendigungen gem. § 474 ff. StPO die Eintragung in das länderübergreifende staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister veranlasst, womit der Bürger zu mindestens intern weiterhin mit einem Strafverfahrensmakel belastet wird.
Soweit das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1994 die Strafvorschriften letztlich dennoch als verhältnismäßig im engeren Sinne betrachtet und das Übermaßverbot nicht für verletzt gesehen hat, vermag dies möglicherweise 1994 noch eine Berechtigung gehabt haben, nicht jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Denn wenn die Gefährdung der geschützten Güter ein so geringes Maß erreicht, dass die generalpräventiven Gesichtspunkte, die eine generelle Androhung der Strafe rechtfertigen, an Gewicht verlieren, kann eine grundsätzlich angedrohte Strafe im Blick auf die Freiheitsrechte des Betroffenen und unter Berücksichtigung der individuellen Schuld des Täters eine verfassungswidrige Situation darstellen. Danach ist mit Blick auf die Strafandrohung gegen den Umgang mit geringen Mengen von Cannabisprodukten zum Zwecke des Eigenkonsums festzuhalten, dass Gefahren letztlich nur entstehen, wenn der Konsument nicht nur gelegentlich Haschisch oder Marihuana zu sich nimmt, sondern erst bei übermäßigem, in kurzem Abstand stattfindenden Gebrauch – was letztlich aber nicht wissenschaftlich gesichert ist. Weitere Gefahren für die Allgemeinheit oder auch für den Einzelnen ergeben sich nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen durch den Konsum von Cannabisprodukten nicht.
Dagegen ist die Intensität des Eingriffs in das Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 insgesamt, jedenfalls solange lediglich der Umgang mit geringen Mengen von Cannabisprodukten verfolgt wird, sehr erheblich. Wie oben dargelegt, muss der Betroffene sich ein polizeiliches und staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen sich erdulden, gegebenenfalls anschließend die gerichtliche Hauptverhandlung und danach die Vollstreckung einer in diesem Verfahren ausgesprochenen Geld- oder Freiheitsstrafe. Und auch eine Auflage nach § 153 a StPO hat letztlich Strafcharakter. All diese Eingriffe in das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit sind zur Überzeugung des Amtsgericht Bernau bezüglich Konsumentenverhalten heute nicht mehr als verfassungsgemäß zu werten. Eine Verfassungswidrigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn, wie im vorliegenden Fall, eine Fremdgefährdung allein als abstrakte Gefahr vorliegt und die Strafbarkeit des Erwerbens und Besitzens geringer Mengen daran anknüpft, dass diese abstrakte Gefahr zwar noch zu keiner konkreten Gefahr wird, aber allein das besessenen Cannabis die Fremdgefährdung wahrscheinlicher werden lässt.
Abgesehen davon, dass das Übermaßverbot regelmäßig – wie der vorliegende Fall zeigt – verletzt wird, führt eine sachgemäße Abwägung heutzutage dazu, dass mittels der Ermessensentscheidungen bei Staatsanwaltschaft und Gericht die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Prinzipien nicht herbeigeführt werden kann. Insoweit verstoßen die zur Überprüfung gestellten Strafvorschriften gegen das Übermaßverbot und verletzen damit den Bürger und vorliegend den Angeklagten in seinem Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG.
2. Verstoß gegen Art.2 Abs.1 GG i. V. m. mit dem Recht auf Rausch
Bezüglich der Verletzung des Rechts auf Rausch wird auf die Ausführungen zu II Seite 99 Bezüglich des Konsumentenverhaltens gelten die obigen Ausführungen angesichts der durch Konsumenten nicht herbeigeführter Gefährdungen Anderer noch mehr.
3. Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 GG
Die Strafverfolgung der Cannabiskonsumenten verstößt angesichts des heutigen Wissens gegen das Freiheitsrecht der Bürger gemäß Art. 2 Abs.2 Satz 2 GG. Wie oben bereits ausgeführt, ist gemäß Art. 2 Abs.2 Satz.2 GG die Freiheit der Person unverletzlich. In dieses Freiheitsrecht darf nur aufgrund des Gesetzesvorbehalts des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG eingegriffen werden. Im vorliegenden Fall hatte sich der Angeklagte bereits mehrerer Freiheitsbeeinträchtigungen zu unterziehen. Er könnte – sofern das Gericht diesbezügliche Anträge positiv bescheiden würde – mittels des Erlasses eines Vorführungsbefehls oder gar Haftbefehls weiter in seiner Freiheit beeinträchtigt werden. Das Gericht wäre in der Lage Freiheitsstrafe oder Geldstrafe zu verhängen. Letztere wäre für den Fall der Nichtbezahlung mit Ersatzfreiheitsstrafe verbunden.
Wie oben bereits ausgeführt sind Freiheitsentziehungen nur zulässig, wenn der Schutz anderer oder der Allgemeinheit dies unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordern. Soweit Handlungsweisen im Umgang mit Cannabis unter Strafe gestellt werden, die lediglich dem Eigenkonsum dienen, stellt sich diese Strafverfolgung angesichts des wissenschaftlichen Standes als nicht mehr verhältnismäßig dar. Die Gefahren für Dritte oder für die Allgemeinheit sind bei geringen Mengen Cannabis zum Eigenverbrauch dermaßen gering, dass sie die Androhung oder Verhängung von freiheitsentziehenden Maßnahmen in keinem Fall mehr rechtfertigen. Dem Gesetzgeber dürfte es mittlerweile verwehrt sein, den Staatsanwaltschaften und Gerichten die Möglichkeit zu geben, Konsumenten mit Freiheitsentzug zu belegen. Es ist nicht verfassungsgemäß, dass es im Ermessen der unterschiedlichsten subjektiven Wertungen verschiedener Staatsanwälte und Richter steht, ob jemand einer freiheitsentziehenden Maßnahme zugeführt wird oder nicht.
Wenn dies aber der Fall ist, dann verstoßen die zur Überprüfung gestellten Strafvorschriften auch gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG.
4. Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG in Bezug auf die Rechtsanwendungspraxis des §31 a BtMG
Die derzeitige strafrechtliche Verfolgungspraxis bezüglich Cannabiskonsumenten und deren Verhaltensweisen verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz gem. Art 3 Abs. 1 GG. Die Praxis der Bundesländer bei der Umsetzung der Vorgaben der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 genügt den zuvor dargelegten Anforderungen nicht und verstößt deshalb gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Wesentlich gleiche Sachverhalte werden durch unterschiedliche Verwaltungsrichtlinien und das sich darauf stützende Handeln der Ermittlungsbehörden ungleich behandelt. Die ungleiche Behandlung der Beschuldigten durch die Staatsanwaltschaften der verschiedenen Bundesländer ist offensichtlich. Für die Ungleichbehandlung durch die unterschiedlichen Bundesländer ist keine sachliche Rechtfertigung erkennbar. Die – geringen – Gefahren, die von Cannabisprodukten ausgehen, existieren jedenfalls in Baden-Württemberg genauso wie in Berlin oder in Rheinland-Pfalz. Die durch die verschiedenen Bundesländer bzw. deren Justizminister oder Generalstaatsanwälte erlassenen Richtlinien umfassen eine zu große Spannbreite. Für Betroffene führt dies zur willkürlich unterschiedlichen Rechtsanwendung.
Dies wird besonders deutlich, wenn man die Tatsache mit einbezieht, dass es letztlich nur von Zufälligkeiten abhängt, ob eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz von einer Staatsanwaltschaft verfolgt wird, die eher einen niedrigen Grenzwert annimmt, oder von einer Staatsanwaltschaft, die in dieser Hinsicht großzügigere Anweisungen hat. Im Fall von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern hängt dies nur davon ab, in welchem Bundesland sie bei Begehen der Tat wohnen. Bei Erwachsenen greift das Tatortprinzip, unter Umständen aber auch das Wohnortprinzip. Eine Vorhersehbarkeit für betroffene Besitzer kleiner Mengen an Cannabis existiert daher nicht. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die prozessuale Lösung nicht zu dem erhofften Erfolg geführt hat und gleiche Personen für das Gleiche unterschiedlich verfolgt und diskriminierenden Eingriffen ausgesetzt oder bestraft werden bzw. verfolgt und diskriminierenden Eingriffen ausgesetzt oder bestraft werden können. Der Rechtszustand ist seit der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts durch die Entscheidung von 1994 bekannt. Vereinheitlichungsbemühungen sind seit 26 Jahren nur teilweise erfolgt. Die Fortdauer dieser uneinheitlichen Rechtsanwendung zur Vermeidung unnötiger Strafverfolgung und Strafverfolgungsmaßnahmen gegenüber Bagatellfällen, also dem Besitz geringer Mengen zum Eigenkonsum, die als Fälle eigenverantwortlicher Selbstgefährdung gewertet werden müssen, wird bereits durch den Zeitablauf von nunmehr 26 Jahren grob willkürlich.
Das Maß der Ungleichbehandlung ist durch die „prozessuale Lösung“ der Einstellung nach § 31a BtMG, nach §§ 153, 153a StPO, §§ 45, 47 JGG nicht beseitigt.
a) Gegenwärtige Praxis
Entgegen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes verliefen die Bemühungen der Länder, zu einheitlichen Richtlinien zu gelangen, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolglos. Vielmehr gaben sich die Bundesländer die unterschiedlichsten Richtlinien Vergleicht man diese Richtlinien, so offenbart sich bereits bei einer ersten Sichtung ein erheblicher Auffassungsunterschied bei der Bestimmung der geringen Mengen von Cannabisprodukten.
Des Weiteren zeigen die Richtlinien bereits eine unterschiedliche Behandlung von Wiederholungstätern einerseits und auch eine unterschiedliche Behandlung von Jugendlichen und Heranwachsenden andererseits . In der Folge der unterschiedlichen Grenzbestimmungen durch die Länder behandeln die Staatsanwaltschaften der jeweiligen Bundesländer Konsumenten von Cannabisprodukten unterschiedlich. Während es in einem Bundesland zur Anklage und in der Folge in aller Regel zu einer Verurteilung kommt, wird in einem anderen Bundesland eingestellt. So zeigt bereits das zur Entscheidung vorgelegte Verfahren exemplarisch, die unterschiedliche Behandlung über die Bundesländergrenzen hinweg.
Unter Berücksichtigung der zuvor zu B 2 aufgelisteten Zahlen bezüglich der Verfolgung von Konsumenten dürfte über 20000 Fälle vorliegen. Allerdings zeigt bereits jeder Einzelfall – wie auch der vorliegende –, dass die gegenwärtige Rechtslage jedenfalls die Möglichkeit beinhaltet, einzelne Bürger unterschiedlich zu behandeln. Dies und nicht etwa die Annahme einer im Wesentlichen gleichen Rechtsanwendungspraxis dürfte entscheidend sein.
b) Formelle Prüfung des Gleichheitsgrundsatzes
Abgesehen hiervon verstößt die bestehende Praxis nach Auffassung des Amtsgerichts Bernau bei Berlin auch bei formeller Prüfung gegen Art. 3 Abs. 1 GG.
aa) Verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Gleichheitsgrundsatzes
Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verlangt zum einen eine Rechtsanwendungsgleichheit (Gleichheit vor dem Gesetz) und zum anderen eine Rechtssetzungsgleichheit (Gleichheit des Gesetzes).
Das Bundesverfassungsgericht hat diese verfassungsrechtlichen Gebote regelmäßig dahingehend konkretisiert, dass der Gleichheitssatz es dem Gesetzgeber verbiete, wesentlich Gleiches willkürlich ungleich oder wesentlich Ungleiches willkürlich gleich zu behandeln (BVerfGE 1, 14, 16, 49, 148, 195). Dabei soll nicht jede Ungleichbehandlung den Gleichheitssatz verletzen. So soll es grundsätzlich dem Gesetzgeber obliegen, bestimmte Sachverhalte als gleich oder differenzierungsbedürftig einzuordnen. Dabei kommt ihm ein weitreichender Beurteilungsspielraum zu. Auch dieser Beurteilungsspielraum unterliegt allerdings der Schranke des Willkürverbots, so dass bei der Frage einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG es entscheidend darauf ankommt, ob die Ungleichbehandlung mit sachlich vernünftigen Gründen zu rechtfertigen ist (so die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vgl. BVerfGE 17, 122, 130; 71, 39, 53).
In der sogenannten „Neuen Formel“ hat das Bundesverfassungsgericht diese sachlichen Gründe weiter präzisiert. Demnach ist eine ungleiche Behandlung dann gerechtfertigt, wenn zwischen zwei Gruppen „Unterschiede in solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen“ (vgl. BVerfGE 55, 72, 88; 85, 238, 244).
Dabei ist der regelnde und gestaltende Staat im Grunde genommen frei, Unterschiede zu schaffen. Dies jedoch nur, sofern unterschiedliche Behandlungen Zwecken, die mit der Ungleichbehandlung verfolgt werden, dienen. In diesen Fällen kann allerdings die Rechtfertigung nicht mehr in den Unterschieden selbst liegen, sondern nur in den Zwecken, die mit der Ungleichbehandlung verfolgt werden (vgl. Pieroth-Schlink, Grundrechte 17. Auflage, 2001, Rdnr. 441).
bb) Bundesweite Vergleichbarkeit als Maßstab der Gleichbehandlung
Grundsätzlich ist eine Ungleichbehandlung durch staatliche Stellen verfassungsrechtlich nur relevant, wenn sie durch die gleiche Rechtssetzungsgewalt erfolgt. Insbesondere für die Behandlung durch staatliche Gewalt verschiedener Bundesländer gilt dieser Grundsatz, was sich aus der föderalen Gliederung der Bundesrepublik Deutschland, wie sie in Art. 20 Abs. 1 und Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegt wurde, ergibt. Demnach ist es grundsätzlich möglich, dass die verschiedenen Bundesländer bei der Ausübung ihrer Gesetzgebungskompetenzen ebenso wie in ihrer Verwaltungspraxis von den gesetzlichen Spielräumen unterschiedlich Gebrauch machen. Allerdings findet auch dieses Recht zur Differenzierung seine Grenzen in dem in Art. 72 Abs. 2 GG anklingenden Gebot zur Wahrung bzw. Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse. Gerade im Bereich der Strafrechtspflege, die eine der härtesten Eingriffe des Staates in die Freiheitsrechte seiner Bürger darstellt, muss dieses Gebot aber – trotz des föderativen Staatsaufbaus der Bundesrepublik Deutschland – besondere Beachtung finden. So hat es auch speziell für den Bereich der Strafverfolgung in gesetzlichen Regelungen Niederschlag gefunden, insbesondere durch die Vorlagepflicht der Oberlandesgerichte an den Bundesgerichtshof, wenn sie von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des Bundesgerichtshofes abweichen wollen. So soll diese Verpflichtung dazu beitragen, solche Divergenzen bei der Rechtsanwendung zu vermeiden, die durch das föderative Gefüge der Strafrechtspflege bedingt sind. Führt die Praxis in den einzelnen Ländern hingegen nicht zu nicht mehr hinnehmbaren Unterschieden, was der Fall ist, wenn zwischen den einzelnen Bundesländern extreme Gefällesituationen bzw. unerträgliche Verschiedenheiten auftauchen, dann sind diese Unterschiede jedenfalls nicht mehr mit der Gliederung der Bundesrepublik in die Länder in Einklang zu bringen (vgl. Maunz / Dürig / Lerche Grundgesetzkommentar zu Art. 83, Rdnr. 10).
Im Beschluss vom 09.03.1994 hat das Bundesverfassungsgericht unter Berücksichtigung der zuvor dargelegten Ausgestaltung des Gleichheitsgrundsatzes deutlich gemacht, dass bei der Anwendung der diversen Einstellungsvorschriften im Bereich der mit dem Umgang mit Cannabisprodukten aufgeführten Strafvorschriften eine einheitliche Rechtsanwendungspraxis geboten ist.
cc. Gleichheitssatz und Verfahrensweisen der Länder
Die Praxis der Bundesländer bei der Umsetzung der Vorgaben des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 09.03.1994 genügt nach Ansicht des Amtsgerichts Bernau bei Berlin den zuvor dargelegten Anforderungen nicht und verstößt deshalb gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Wesentlich gleiche Sachverhalte werden durch Verwaltungsrichtlinien ungleich behandelt.
So sind zunächst die in den 16 Bundesländern verfolgten Sachverhalte im Wesentlichen gleich. Die Beschuldigten sind bei polizeilichen Maßnahmen im Besitz von Cannabisprodukten aufgegriffen worden, wobei die festgestellten Mengen sich in den gleichen Rahmen bewegten. In vielen Fällen sagen die Beschuldigten in den sich anschließenden polizeilichen Vernehmungen freimütig aus und erklären oftmals auch, wie oft sie Cannabisprodukte konsumiert haben. In allen diesen Fällen sind keine wesentlichen Unterschiede erkennbar, die dazu führen könnten, dass die in verschiedenen Bundesländern verfolgten Fälle nicht unter einem gemeinsamen sinnvollen Bezugspunkt, und zwar durch den Gesetzgeber, gefasst werden könnten. Dieser Bezugspunkt besteht in dem Konsum geringer Mengen von Cannabisprodukten und den damit verbundenen Vorbereitungshandlungen.
5. Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG - Gesetzlichkeitsprinzip
Gemäß Art. 103 Abs. 2 GG kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Das Gesetzlichkeitsprinzip, das nichtnur in Art. 103 Abs. 2 GG, sondern auch in § 1 StGB gleichlautend formuliert wurde, setzt für die Bestrafung eines Verhaltens die vorherige gesetzliche Bestimmung der Strafbarkeit und auch deren mögliche Strafsanktionen voraus (vgl. Fischer, StGB, 65. Auflage, zu § 1, Rndr.
1. Diese Verpflichtung bezieht sich auf jede staatliche Maßnahme, „die eine missbilligende hoheitliche Reaktion auf ein schuldhaftes Verhalten enthält“ (vgl. BVerfGE 26, 186, 203 ff. 45, 346, 351).Die Verfassungsgarantie des Art. 103 Abs. 2 GG dient dabei einem doppelten Zweck:
Einerseits soll jedermann vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit Strafe versehen ist. Andererseits soll sichergestellt werden, dass über die Strafbarkeit durch die verfassungsmäßig dazu berufene Institution, nämlich dem Gesetzgeber, bestimmt wird.
Insoweit enthält Art. 103 Abs.2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der vollziehenden und rechtssprechenden Gewalt verwehrt, selbstständig über die Voraussetzung der Strafbarkeit zu entscheiden (vgl. Hill, Rechtsschutz und Staatshaftung, Rndr. 61, mit weiteren Nachweisen; Isensee / Kirchhoff, Handbuch des Strafrechts Band VI, 1989).
Die gegenwärtige Praxis im Umgang mit Cannabiskonsumenten verstößt gegen beide Aspekte des Gesetzlichkeitsprinzips.
a) Vorhersehbarkeit
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts führt das Erfordernis der Vorhersehbarkeit der Strafbarkeit für die Normadressaten dazu, dass der Einzelne die Möglichkeit hat, sein Verhalten auf die Rechtslage einzurichten; er soll die Tragweite und den Anwendungsbereich des Straftatbestandes erkennen oder durch Auslegung ermitteln können (vgl. BVerfGE 87, 224 ff.). „Jeder soll vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit Strafe bedroht ist. Im Rahmen des Bestimmtheitsgrundsatzes ist es dem Gesetzgeber zwar grundsätzlich erlaubt, seine Vorgaben abstrakt zu umreißen und dabei insbesondere auf unbestimmte Gesetzesvorschläge zurückgreifen“ (Maunz - Dürig, Art. 103 Abs. 2, Rdnr. 186). Dies darf er allerdings nur dann, wenn die unbestimmten Rechtsbegriffe der näheren Deutung im Wege der Auslegung zugänglich sind. Maßgebendes Kriterium ist dabei der Gesetzestext: Der mögliche Wortsinn markiert die äußere Grenze zulässiger richterlicher Interpretation (vgl. BVerfGE 71, 108, 115; 73, 206, 235). Demnach steht eine Verurteilung, die auf einer objektiv unhaltbaren und damit willkürlichen Auslegung des geschriebenen materiellen Strafrechts beruht, erst recht in Widerspruch zu Art. 103 Abs. 2 GG (vgl. Hill a. a. o., Rdnr. 61). Für die Normadressaten der hier aufgegriffenen Normen des Betäubungsmittelgesetzes ist nicht mehr vorhersehbar, mit welchem Verhalten sie sich der Strafverfolgung unterziehen. Sie können nicht erkennen, welche Mengen Cannabis sie bei sich führen dürfen, ohne sich der Gefahr eines gerichtlichen Strafverfahrens und evtl. anschließender Verurteilung auszusetzen.
Bereits die unterschiedlichen Richtlinien in den Bundesländern sind für die Bürger dermaßen unübersichtlich, dass kaum ein Bürger weiß, ob er sich und vor allen Dingen wo er sich gerade wegen welcher Menge einer Strafverfolgung unterziehen muss oder aber nicht. So wissen selbst Fachdezernenten oder Richter, die jahrelang mit Betäubungsmittelverfahren zu tun haben, oftmals nicht, welche Regelungen in anderen Bundesländern gelten. Wenn dies allerdings noch nicht einmal bei Fachpersonal der Fall ist, wie soll dann der Bürger, der ohne Zugang zu Rechtsliteratur ist, wissen, wie und wo er sich gerade strafbar macht. Während jeder Bürger weiß, dass er sich strafbar macht, wenn er auch nur die geringste Sache wegnimmt, ist dies im Bereich von Cannabispönalisierung nicht mehr der Fall. Politiker aller Parteien wie selbst Drogenbeauftragte erklären öffentlich, dass der Konsum von Cannabis nicht strafbar sei. Dies in Unkenntnis, das dem Konsum in aller Regel strafbares Vorbereiten des Konsums und auch strafbarer Besitz vorausgeht. Lehrer unterrichten Schüler gerichtsbekannt dahingehend, dass der Besitz von bis zu 6 Gramm nicht strafbar sei. Dies in Unkenntnis, dass selbst die kleinste Menge sicher zur polizeilichen, und auch zur staatsanwaltschaftlichen und insbesondere bei Jugendlichen und Heranwachsenden auch zu einer gerichtlichen Verfolgung führen kann. Die vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 1994 gewählte prozessuale Lösung hat eine Verwirrung für den Normadressaten geschaffen.
Sehr, sehr viele Menschen und insbesondere auch Jugendliche denken, dass eine Strafverfolgung nicht droht. Man stelle sich einen Schausteller vor, der mit 9 g Cannabis durch die Bundesländer zieht. Er würde sich bei einem Wechsel über die Grenzen der verschiedenen Bundesländer mal der gerichtlichen Strafverfolgung aussetzen und mal wieder nicht. Und wäre er bereits einmal wegen eines Betäubungsmitteldeliktes in Erscheinung getreten oder stünde unter Bewährung noch mehr. Vorhersehen und damit sein Verhalten darauf abstimmen, indem er z.B. einen Teil des Betäubungsmittels vernichtet, könnte er nicht. Einer Verurteilung könnte er als Konsument nur vermeiden, sofern er die jeweiligen Richtlinien der verschiedenen Staatsanwaltschaften bzw. Bundesländer kennen würde. Da diese noch dazu jederzeit geändert werden können wie noch das Bundesland Bremen Anfang des Jahres 2020 gezeigt hat, müsste er darüber hinaus sicher stellen, auch immer die allerneuste Fassung der Richtlinie zur Hand zu haben. Allein dieses Beispiel zeigt, dass von einer hinreichenden Bestimmtheit, die dem Gesetzgeber obliegt, nicht gesprochen werden kann.
Der Normadressat kann nicht mehr einschätzen, ob seine Verhaltensweise tatbestands- oder sanktionsrelevant ist. Er unterliegt mithin der Willkür und den jeweiligen Moralvorstellungen der verschiedenen Justizminister, Landesregierungen oder Generalstaatsanwälten und darüber hinaus auch den der verschiedenen tätig werdenden Richter oder Staatsanwälte.
b) Bestimmung der Strafbarkeit durch den Gesetzgeber
Weiterhin verstößt die derzeitige Verfahrensweise auch insoweit gegen den Bestimmungsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG, als das nicht mehr der Bundesgesetzgeber die Grenzen der Strafbarkeit bestimmt, sondern die Generalstaatsanwaltschaften oder die Justizminister der Länder (vgl. Büttner, S. 155, m. w. N.). Durch den Gesetzlichkeitsgrundsatz soll aber sichergestellt werden, dass der Gesetzgeber selber über die Strafbarkeit entscheidet. (BVerfGE 78, 374, 382 unter Bezugnahme auf BVerfGE 47, 109, 201).
Mit seinem Beschluss vom 09.03.1994 hat das undesverfassungsgericht letztlich aber den Strafverfolgungsbehörden und mithin der Exekutive die Funktion zugeordnet, mittels des in der Regel zu erfolgenden Strafverfolgungsverzichts die legitimen Grenzen eines zu weit geratenen materiellen Tatbestands zu gewährleisten (vgl. Büttner, S. 153). Damit unterliegt die Bestimmung der Strafbarkeit nicht mehr dem Gesetzgeber, sondern der Exekutive, nämlich den Staatsanwaltschaften und Justizministern.
Zwar kam dem Bestimmtheitsgebot und auch dann genüge getan sein, wenn im Rahmen der gesetzlichen Regelung auf ungesetzliche Normen verwiesen wird. So geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass die gesetzliche Strafandrohung mit einem Verweis auf eine Verordnung oder auch einen erst noch zu erlassenen Verwaltungsakt verknüpft sein könne. Aber auch insoweit müssten nach den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts die Voraussetzung der Strafbarkeit und die Art der Strafe für den Bürger bereits aufgrund des Gesetzes und nicht erst aufgrund der hierauf gestützten Verordnung erkennbar sein. Der Gesetzgeber habe die Voraussetzungen der Strafbarkeit selbst zu bestimmen und dürfe diese Entscheidung nicht den Organen der vollziehenden Gewalt überlassen. Gleiches gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entsprechend auch für die Knüpfung der Strafandrohung an die Nichtbefolgung eines Verwaltungsaktes (vgl. BVerfGE 78, 374, 382).
Nach diesen Grundsätzen verstößt die derzeitige Praxis bei der Strafverfolgung des Umgangs mit geringen Mengen Cannabis gegen Art. 103 Abs. 2 GG. Denn die Grenzen der Strafbarkeit werden nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch Richtlinien der Bundesländer und deren Staatsanwaltschaften als Teil der Exekutive bestimmt (vgl. auch Sondervotum Sommer BVerfGE 90, 145, 224). Diese entscheiden nicht nur – wie bereits dargestellt – von Bundesland zu Bundesland äußerst unterschiedlich, sondern sind auch in der Lage ihre behördeninternen Vorschriften jederzeit – insbesondere auch ohne für Außenstehende nachvollziehbare Gründe – zu verändern.
Die Frage, bis zu welchen Mengen Cannabis von geringen Mengen ausgegangen werden soll, entscheidet darüber, ob ein Angeklagter sich eines strafrechtlichen Verfahrens auszusetzen hat oder ob das Verfahren eingestellt wird. Damit stellt die Einstufung einer Cannabismenge als „gering“ die entscheidende Voraussetzung der Strafbarkeit dar. Diese wird aber derzeit nicht durch den Gesetzgeber nach den dafür vorgesehenen Formen und Verfahren bestimmt. Dies würde dazu führen, dass in einem der Öffentlichkeit nachvollziehbaren Prozess durch die zuständigen Gremien, insbesondere dem Bundestag und seinen Ausschüssen, über die Frage befunden würde, bis zu welchem Wert jeder einzelne straffrei mit Cannabisprodukten umgehen kann. Vielmehr entscheiden derzeit Vertreter der Exekutive in einem nicht nachvollziehbaren und durch die Öffentlichkeit nicht zu kontrollierenden, wohl schon als willkürlich zu bezeichnenden Verfahren über dieses entscheidende Kriterium der Strafbarkeit. Die prozessuale Lösung des Bundesverfassungsgerichts vermochte nicht der Doppelfunktion des gesetzlichen Bestimmtheitsgebotes des Grundgesetzes gerecht zu werden, da die Grenzen der Strafbarkeit von falschen Institutionen, ohne Öffentlichkeit und nach Auffassung des Amtsgerichts Bernau bei Berlin wiederholt bundesweit in willkürlicher Weise festgelegt wurden und werden.
IV.
Verfassungskonforme Auslegung
Opportunitäts- und Strafzumessungserwägungen
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht ist ein Vorlageverfahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dann nicht zulässig, wenn eine verfassungskonforme Auslegung möglich ist ( vgl. BVerfGE 32,373,383; 54,251,273).
Zunächst ergibt sich vorliegend nicht die Möglichkeit, im Rahmen von Opportunitätsentscheidungen und Strafzumessungserwägungen auf den individuellen Unrechts- und Schuldgehalt einzugehen. So ist etwa im vorliegenden Fall dem vorlegenden Gericht eine Entscheidung nach §§ 153,153 a Abs. 2 StPO und § 31a Abs.2 BtMG verwehrt, da es an der mangelnden Zustimmung der Beteiligten fehlt.
Eine verfassungskonforme Auslegung dahingehend, dass bei geringen Mengen freizusprechen ist, scheitert an einer Auslegungsfähigkeit des § 29 BtMG. So darf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht eine verfassungskonforme Auslegung nicht dazu führen, dass der normative Gehalt und der Zweck der Rechtsvorschrift geändert wird (vgl. BVerfGE 78,20,24; 71,81,105) Dies gilt insbesondere dann, wenn es dem Gesetzgeber freigestellt ist, eine Regelung zu ändern oder durch eine verfassungsgemäße Norm zu ersetzen. Das will der gewärtige Gesetzgeber trotz verschiedener Gesetzesinitiativen gerade nicht. Er möchte erklärtermaßen an der Cannabispönalisierung fest festhalten.
Auch die Möglichkeit des Gerichts gemäß § 29 Abs. 5 BtMG von Strafe abzusehen, kann nicht zu einer verfassungsgemäßen Auslegung und Anwendung der vorgelegten Norm führen. Denn diese Norm setzt voraus, dass sich der Angeklagte gemäß § 29 Abs.1 BtMG grundsätzlich strafbar gemacht hätte. Das vorlegende Gericht geht aber , wie dargestellt von der Verfassungswidrigkeit dieser Vorschrift in Bezug auf Cannabis aus. Auch müsste der Angeklagte schuldig gesprochen und ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt werden.
Schließlich hätte die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, ein Rechtsmittel einzulegen, was zu einer weiteren Belastung des Angeklagten führen würde.
Soweit das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 9.3.1994 auf die Möglichkeit des § 29 Abs. 5 BtMG hingewiesen hat ist diese Möglichkeit angesichts des zuvor Ausgeführten nicht zielführend, um die verfassungswidrigen Eingriffe in die Rechte des Angeklagten zu beseitigen. Das zeigt im Übrigen auch die Strafrechtspraxis. So machten die Gerichte lediglich in 0,1 % aller Fälle bei konsumnahen Delikten im Bereich des § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG gebrauch (vgl. Möller S.65).
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass vorliegend eine verfassungskonforme Auslegung nicht möglich ist.
Nach alldem steht zur Überzeugung des vorlegenden Gerichts fest, dass die vorliegend zur Anwendung kommende Vorschrift des § 29 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage I (hier Cannabis) BtMG in der Handlungsalternative des Besitzes nicht geringer Mengen aus den oben Punkten aufgeführten Gründen gegen die dort aufgeführten Grundgesetzartikel verstoßen. Eine erneute Entscheidung über die vorgelegten Normen ist aufgrund der dargelegten neuen sowie entscheidungserheblichen Tatsachen erforderlich und geboten.
Abhilfe kann auch nicht mit dem Mittel der verfassungskonformen Auslegung geschaffen werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ein Vorlageverfahren gemäß Art. 100 Abs.1 GG dann nicht zulässig, wenn eine verfassungskonforme Auslegung möglich ist. Eine solche verfassungskonforme Auslegung kommt dann in Betracht, wenn eine auslegungsfähige Norm nach den üblichen Interpretationsregeln mehrere Auslegungen zulässt, von denen eine oder mehrere mit der Verfassung übereinstimmen, während andere zu einem verfassungswidrigen Ergebnis führen; solange eine Norm verfassungskonform ausgelegt werden kann und in dieser Auslegung sinnvoll bleibt, darf sie nicht für nichtig erklärt werden (vgl. BVerfGE 48, 45 m. w. N.). Die hier zu Anwendung kommenden Normen des Betäubungsmittelstrafrechts lassen keine verfassungskonforme Auslegung im vorgenannten Sinne zu. Sie sind bei dem hier festgestellten Sachverhalt nach den üblichen Interpretationsregeln eindeutig und ermöglichen keine Auslegung, die zur Straffreiheit der Angeklagten führt.
Unter Berücksichtigung aller gewonnenen Erkenntnisse kommt das Amtsgericht zur Überzeugung, dass seit dem Jahre 1994 regelmäßig zu mindestens was Konsumentenverhalten betrifft gegen Grundrechte der Bürger verstoßen wurde und weiter wird. Nur das Bundesverfassungsgericht ist in der Lage, dem Gesetzgeber deutlich zu machen, dass es seine Aufgabe ist, Bürger vor verfassungswidrigem Handeln der Exekutive und der Justiz zu bewahren.
- nach oben -
Fußnoten:
1 Vertiefend zu Botanik, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik vgl. Kleiber, Dieter/ Kovar, Karl-Arthur, Auswirkungen des Cannabiskonsums. Eine Expertise zu pharmakologischen und psychosozialen Konsequenzen, 1997, S. 238 ff.
2 Anfang des Jahres 2019 wurden die Ergebnisse der im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführten CaPRis-Studie unter dem Titel „Cannabis: Potenzial und Risiko. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme“ (Hrsg.: Hoch, Eva/Friemel, Chris M./Schneider, Miriam) veröffentlicht. Insbesondere unter methodologischen Aspekten wird die Studie vielfach kritisiert. So gilt bereits der Forschungsauftrag durch das Bundesministerium als tendenziös gestellt insoweit, als zum Thema „Cannabiskonsum zum Freizeitgebrauch“ lediglich die Risiken, nicht aber auch die positiven Auswirkungen von Cannabiskonsum untersucht werden sollten. Weitere Kritik knüpft sich daran an, dass es sich bei der CaPRis-Studie im Wesentlichen um statistisch geprägte Tertiärforschung handelt, welche überwiegend systematische Reviews und wenige klinische Studien beinhaltet (zu einer umfassenden Kritik der Studie vgl. unter II. Vgl. zur Kritik an der Studie [folgt eine URL].
3 Bei dem Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel (engl. Single Convention on Narcotic Drugs) handelt es sich um einen von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten völkerrechtlichen Vertrag von 1961 über Verbot und Kontrolle der Produktion und Verbreitung von in den Anlagen des Vertrages (Schedule I bis IV) gelisteten Substanzen. Cannabis ist dabei in Schedule I und IV gelistet und wird damit im Hinblick auf Umgang und Kontrolle gleichgestellt mit Substanzen wie Opiaten, Opium und Heroin. Die Suchtstoffkommission der UNO sowie die Weltgesundheitsorganisation Drogen sind ermächtigt, Substanzen entsprechend den vier Anlagen des Vertrages neu aufzunehmen, zu entfernen und neu zu kategorisieren.
4 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich mittlerweile eine kaum überschaubare Menge an Studien und Forschungsarbeiten angesammelt hat, die in ihren Ergebnissen teilweise stark voneinander abweichen oder sich sogar diametral widersprechen. Dies kann u. a. auf unterschiedlichste Studiendesigns und Fragestellungen, methodische Unzulänglichkeiten sowie auf die Tatsache, dass die komplexen Zusammenhänge zwischen Konsum von Cannabis und seinen möglichen Auswirkungen – insbesondere vor dem Hintergrund der Prohibition – wissenschaftlich nur schwer zu erfassen sind, zurückgeführt werden (vgl. hierzu auch Möller, S.133 ff.). Vorliegend wird als Grundlage die im Auftrag des Gesundheitsministeriums erstellte Expertise von Prof. Kleiber und Prof. Kovar herangezogen (vgl. Kleiber, Dieter/Kovar, Karl-Arthur, Auswirkungen des Cannabiskonsums. Eine Expertise zu pharmakologischen und psychosozialen Konsequenzen, 1997) sowie die 2018 erschienene Dissertation von Yannick Möller (vgl. hierzu Möller, Yannick: Die Prohibitionspolitik als Element sozialer Kontrolle, 2018) und um weitere Studien und Forschungsergebnisse ergänzt. Unter der Leitung von Prof. Kovar wurden am Pharmazeutischen Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen umfangreiche Basisdaten zur Botanik und Chemie der Inhaltsstoffe, zur Pharmakokinetik und - dynamik aufgeführt sowie kurzfristige und langfristige pharmakologische und toxikologische Wirkungen dargestellt. Psychische und soziale Konsequenzen des Cannabiskonsums wurden unter der Leitung von Prof. Kleiber an der Freien Universität Berlin (Institut für Prävention und psychosoziale Gesundheitsforschung) zusammengetragen. Ergebnisse anderer, auch der CaPRis Studie werden dort wiedergegeben, wo sie den Forschungsergebnissen von Kleiber/Kovar widersprechen.
5 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die meisten Studien, welche erhebliche Gefahren für die körperliche Gesundheit feststellen, von einem chronischen Dauerkonsum ausgehen, welcher dem durchschnittlichen Konsummuster von Cannabis gerade nicht entspricht (vgl. Möller, S. 78).
6 Facharzt an der Wiener Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Ruhestand und Board Member der International Acadamy of Law and Mental Health.
7 Univ. Prof. Dr. Rainer Schmidt, Chemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung Toxikologie und Medikamentenanalytik am AKH Wien; Leiter der Medical Cannabis Research & Analysis GmbH
- nach oben -